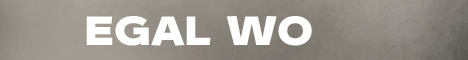Serie Smart CitiesWo das Datenherz schlägt

Urbane Datenplattformen sind das Herzstück einer Smart City.
(Bildquelle: mrmohock/stock.adobe.com)
Urbane Datenplattformen stellen einen Teil der zentralen Infrastruktur für eine Smart City dar: Sie sind die Drehscheibe für statische und dynamische Daten aus verschiedenen Quellen in der Stadt. Hier laufen zum Beispiel Verkehrs- und Klimadaten, Echtzeitdaten verschiedener in der Stadt installierter Sensoren sowie unterschiedliche Daten aus der Verwaltung zusammen. Eine urbane Datenplattform bündelt diese Daten an einer zentralen Stelle, wo sie dann mit unterschiedlichen Datenkonsumenten geteilt werden können. Beispielsweise können kommunale Ressorts ihre Daten auf der urbanen Datenplattform ablegen, um der Stadtgesellschaft Zugriff auf sie zu ermöglichen. Die Datenplattform erlaubt also den geregelten Zugriff auf zielgruppenspezifische Daten. Diese können auch visuell aufbereitet sein, beispielsweise indem sie mit begleitenden Infotexten angereichert werden. Darüber hinaus kann eine urbane Datenplattform die Grundlage für weitere Dienste bilden: Sie erlaubt Anbietern von Software-Lösungen und Dienstleistungen den Zugriff auf entsprechende Datensätze, damit sie Nutzen stiftende Angebote für die Stadtgesellschaft realisieren. Eine weitere Funktionalität ist die Möglichkeit zur Weiterverarbeitung von Daten. Damit lassen sich höherwertige Daten schaffen, die automatisiert aus unterschiedlichen Quellen erzeugt werden. So unterschiedlich wie die Datensätze sind auch die Anwendungsmöglichkeiten urbaner Datenplattformen: Über Parkplatzsensoren kann zum Beispiel übermittelt werden, welche Parkplätze belegt sind, um Parkplatzsuchende direkt zum nächsten freien Platz zu leiten. Droht etwa ein Hochwasser, können Bürgerinnen und Bürger frühzeitig gewarnt werden. Darüber hinaus sind urbane Datenplattformen die Grundlage für digitale Zwillinge, mit deren Hilfe komplexe Simulationen und Visualisierungen möglich werden. Entwicklungsgemeinschaft Urbane Datenplattformen Auch die meisten der 73 vom Bund geförderten Modellprojekte Smart Cities setzen urbane Datenplattformen ein, verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze zur Planung und Implementierung. Um sich über praktische Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Lösungen weiterzuentwickeln, hat sich aus den Modellprojekten Smart Cities heraus die Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaft „Urbane Datenplattformen“ gegründet. Beim Kick-off im Herbst 2022 waren 61 Vertreterinnen und Vertreter aus 44 Modellprojekten dabei. Ziel der langfristig und strategisch angelegten Gruppe ist es, sich auf gemeinsame Konzeptionen, Datenmodelle und Schnittstellen zu verständigen. Am Ende soll eine Art Anleitung stehen, aus der Kommunen sich anhand verschiedener Bausteine ihre eigene urbane Datenplattform bereitstellen können. Die einzelnen Bausteine werden dabei als Open-Source-Angebote zur Verfügung gestellt. So können auch Kommunen, die nur über begrenzte eigene personelle und finanzielle Ressourcen verfügen, an Entwicklungen zu urbanen Datenplattformen partizipieren. Derzeit steht die Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaft noch ganz am Anfang: Zunächst gilt es, eine gemeinsame fachliche Grundlage zum technischen Konzept einer urbanen Datenplattform sowie zu der Projektdurchführung von Software-Projekten zu erzielen, um sie dann im nächsten Schritt mit praktischen Erfahrungen anzureichern. Da die Realisierung einer urbanen Datenplattform wesentliche Weichen für den kommunalen Umgang mit Daten setzt, adressiert die Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaft auch grundlegende datenstrategische Fragen. Themenbezogene Arbeitsgruppen zu Data Governance, Architekturen für Datenplattformen oder zur Customer Journey bearbeiten intensiv bestimmte Aspekte einer urbanen Datenplattform. Dabei werden unter anderem Erfolg versprechende Ansätze gesammelt und nach Relevanz ausgewählt. Südwest-Cluster teilt Erkenntnisse Mehrere Modellprojekte Smart Cities im Südwesten Deutschlands arbeiten bereits ganz konkret zusammen und bauen gemeinsam eine intelligente urbane Datenplattform auf. Ziel der bundeslandübergreifenden Entwicklungspartnerschaft im so genannten Südwest-Cluster ist eine modular aufgebaute und skalierbare Plattform mit Schnittstellen zu weiteren Datenquellen. Das Projekt soll den Bürgerinnen und Bürgern neben Daten-Cockpits auch eigene Apps und zentrale Zugangsmöglichkeiten zu Fachverfahren verschaffen. Im Rahmen der jeweils erstellten Smart-City-Strategien der beteiligten Modellprojekte ist das Vorhaben fest verankert, im ersten Schritt sind die Landkreise Bitburg-Prüm, Kusel, Mayen-Koblenz, St. Wendel sowie die Region Linz am Rhein beteiligt. Die technische Grundlage auf Basis von Open Source Software sollen andere Kommunen, insbesondere Landkreise, später nachnutzen können. Dass ein Großteil der teilnehmenden Partner aus dem gleichen Bundesland stammt, bietet dabei die Chance, von vornherein Schnittstellen zu landesweiten Datenquellen zu fokussieren und standardmäßig zum Vorteil aller Kommunen einzubinden. Ihre Erkenntnisse spielen die Arbeitsgruppen vierteljährlich in die Gesamtgruppe zurück. Das macht den Mehrwert der projektübergreifenden Zusammenarbeit besonders deutlich: Anstatt Fragen der Server-Infrastruktur oder juristische Feinheiten zur Offenlegung bestimmter Daten in jeder Kommune neu zu beantworten, führen die Ergebnisse der Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaft dazu, dass Kommunen den Freiraum gewinnen, sich direkt dem Nutzen einer urbanen Datenplattform zu widmen. Allen anderen Kommunen in Deutschland werden die Erkenntnisse der Arbeitsgruppen von der Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities zur Verfügung gestellt. Studienergebnisse kostenfrei einsehen Im Rahmen der Begleitforschung des Förderprogramms Modellprojekte Smart Cities des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ist im Februar 2023 zudem die Studie „Urbane Datenplattformen – Von der Idee bis zur Umsetzung: Entscheidungshilfen für Kommunen“ erschienen. Sie soll Städte und Regionen in die Lage versetzen, zentrale Entscheidungen bei der Einführung einer Datenplattform unter lokalen Gegebenheiten zu treffen, und kann kostenfrei bestellt oder heruntergeladen werden.
Teil 2: Urbane Datenplattformen
Teil 3: Digitale Zwillinge
Teil 4: Smarte Regionen
Teil 5: Resilienz und Klimaanpassung
Teil 6: Raumwirkung der Digitalisierung
Teil eins der Serie Smart Cities
https://www.smart-city-dialog.de/modellprojekte
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe April 2023 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Mannheim: Orientierung für barrierefreies Parken
[20.01.2026] In Mannheim steht eine neue, barrierefreie App für die Suche nach freien Schwerbehindertenparkplätzen zur Verfügung. Park-Stark nutzt Echtzeitdaten von über 250 Stellplätzen und zeigt Verfügbarkeit, Navigation und Alternativen direkt auf dem Smartphone an. mehr...
Mönchengladbach: Fünfter Smart City Summit Niederrhein
[20.01.2026] Mönchengladbach lädt am 26. Februar zur fünften Auflage des Smart City Summit Niederrhein ein. Mit Vorträgen, Workshops und einem großen Ausstellungsbereich richtet er sich an ein Fachpublikum, das sich mit der digitalen Transformation von Kommunen beschäftigt. Dabei werden strategische Perspektiven mit anschaulichen Praxisbeispielen verknüpft. mehr...
Beckum: BE smart
[09.01.2026] Konsequent treibt Beckum die Entwicklung zur Smart City voran. Beispielsweise bietet die Stadt mittlerweile ein digitales Bürgerbüro, eine Mängelmelder-App oder einen Kita-Navigator an. Einige ihrer Digitalisierungsprojekte stellt die Kommune nun in einer digitalen Broschüre und einem Kurzfilm vor. mehr...
Serie Digitalstädte: KI wird uns weiterhelfen
[08.01.2026] Die Ahauser Bürgermeisterin Karola Voß will im Bereich Wissensmanagement noch stärker auf Künstliche Intelligenz setzen und dadurch Ressourcen schonen. mehr...
Serie Digitalstädte: Mit Super-App unterwegs
[07.01.2026] In einer losen Serie stellt Kommune21 Digitalstädte mit Vorbildcharakter vor. Den Anfang macht Ahaus: Die nordrhein-westfälische Stadt ist ein Reallabor für digitale Anwendungen – mit einer Super-App als Schlüssel. mehr...
Kaiserslautern: Geordnete Liquidation von KL.digital
[06.01.2026] Die Stadt Kaiserslautern bereitet die geordnete Liquidation der KL.digital GmbH zum 30. Juni 2026 vor. An diesem Tag endet der Förderzeitraum der Modellprojekte Smart Cities, auf der die finanzielle Grundlage von KL.digital vollständig beruht. Die Projekte und Ideen sollen aber nahtlos in die Stadtverwaltung übergehen und dort weiterentwickelt werden. mehr...
Göttingen: Ausbau des städtischen Messnetzes
[22.12.2025] Ein Sensoriknetzwerk liefert der Stadt Göttingen wichtige Informationen über Wasserstände, die Baumgesundheit und die lokale Klimaentwicklung. Das Netz soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Die Daten sollen unter anderem in Forschung, Analysen und Planungsprozesse einfließen. mehr...
Frankfurt am Main: Digital Ressourcen schonen
[15.12.2025] Die Stadt Frankfurt am Main hat drei weitere Digitalisierungsprojekte umgesetzt: den Aufbau eines digitalen Wassermanagements, die Einführung der automatisierten Straßenzustandserfassung sowie die Open Library. Alle drei Projekte tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen. mehr...
Frankfurt am Main: Informiert zum Parkhaus
[12.12.2025] Viele Parkhausbelegungen in Frankfurt am Main sind jetzt in Echtzeit online einsehbar. Die erfassten Daten können von Verkehrstelematikanbietern oder Radiosendern für eigene Angebote abgerufen werden. Auch an die Mobilithek des Bundes werden sie übertragen. mehr...
Frankfurt am Main: Echtzeitdaten zum Weihnachtsmarkt
[05.12.2025] Ein Pilotprojekt mit LiDAR (Light Detection and Ranging)-Sensoren führt die Stadt Frankfurt am Main während des Weihnachtsmarkts am Römer durch. Die Sensoren messen dort das aktuelle Besucheraufkommen mit Laserstrahlen, die erfassten Daten stehen auf der urbanen Datenplattform in Echtzeit zur Verfügung. mehr...
Troisdorf: Smarter parken
[03.12.2025] Mit einer smarten Lösung bereitet Troisdorf der ineffizienten Parkraumbewirtschaftung ein Ende. Parksensoren erfassen jetzt die Belegung einzelner Stellplätze, die Bürgerinnen und Bürger werden darüber in Echtzeit per App informiert. mehr...
Scan-Fahrzeug: Mannheim verlängert Testphase
[01.12.2025] Die in Mannheim durchgeführte Testphase eines Scan-Fahrzeugs zur Ahndung von Falschparkern wird verlängert. Während der Erprobung zeigte sich Nachbesserungsbedarf bei der Kartierung des Scan-Gebiets. Entsprechende Anpassungen wurden direkt vorgenommen. Wie sie sich auswirken, soll die verlängerte Testphase zeigen. mehr...
Taufkirchen: Sensorik für Winter- und Kehrdienst
[01.12.2025] Dank Internet-of-Things-Sensorik kann der Winterdienst des Taufkirchener Bauhofs effizienter geplant, durchgeführt und dokumentiert werden. Die Gemeinde ist von den Vorteilen überzeugt und möchte diese nun auch bei der Straßenreinigung nutzen. mehr...
Arnsberg: Hochwassermonitoring gestartet
[25.11.2025] Arnsberg hat an mehreren Bachläufen im Stadtgebiet neue Pegelstandsensoren installiert, die in Echtzeit ermitteln, wie sich die Wasserstände entwickeln. Die Daten sollen im nächsten Schritt mittels Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet werden. Auf dieser Grundlage soll wiederum ein lokales Frühwarnsystem entstehen. mehr...
Aachen: Überarbeitetes Mobilitätsdashboard
[24.11.2025] Das Aachener Mobilitätsdashboard bietet einen schnellen und einfachen Überblick über das aktuelle Verkehrsgeschehen in der Stadt. Ein neues Design und neue Technologie sollen die Plattform jetzt noch leistungsfähiger machen. mehr...