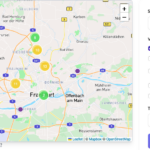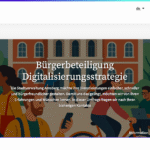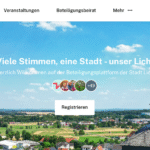REPORTBürgernahes Sachsen
Bis 2020 soll Sachsen die modernsten Verwaltungsstrukturen Deutschlands erhalten. An diesem ehrgeizigen Ziel arbeitet der Freistaat konsequent: 2009 verabschiedet das Kabinett die gemeinsam mit den Kommunen entwickelte E-Government-Strategie. Im Frühjahr 2010 wird die Position eines Chief Information Officer geschaffen. Im Juni wird mit der Umsetzung des E-Kabinetts ein erster Schritt hin zu vollständig elektronischen Verwaltungsprozessen getan. Im August verabschiedet die Sächsische Staatsregierung den Fahrplan für die weitere Modernisierung der Verwaltung bis 2020.
Regionale Arbeitsgruppe E-Government
Im Dezember findet der Nationale IT-Gipfel in Dresden statt. Anlässlich dieses Spitzentreffens ruft Sachsen-CIO Wilfried Bernhardt die Regionale Arbeitsgruppe E-Government ins Leben, die sich der Frage widmen soll, wie der intelligente Einsatz von IT die Leistungsfähigkeit der Verwaltung stärken sowie die Bürgernähe erhöhen kann. Bernhardt: „Für mich ist mit der Regionalen Arbeitsgruppe E-Government eine wichtige Erfahrung des IT-Gipfelprozesses verknüpft: Wir müssen gemeinsam, also organisationsübergreifend und in enger Kooperation mit der Wirtschaft, unsere Verantwortung für die Gestaltung von Rahmenbedingungen und den intensiven Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien wahrnehmen.“ So hat die Arbeitsgruppe unter Leitung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa gemeinsam mit Vertretern der kommunalen Ebene, wie dem Vogtlandkreis oder der SAKD, mit Landesverwaltungen – auch aus der Region Mitteldeutschland – sowie Unternehmen wie IBM, SAP und Siemens das Positionspapier „Verwaltung bürgernah und modern“ erstellt. Darin werden Erfahrungen und Herausforderungen beschrieben und Lösungsvorschläge gemacht. Das Papier will Impulse geben, schlägt aber auch konkrete Maßnahmen für das weitere Vorgehen vor.
Hintergrund der Überlegungen sind die Auswirkungen des demografischen Wandels – auf Verwaltung und Bevölkerung. Sachsen-CIO Bernhardt schreibt im Vorwort: „Wir werden schon in naher Zukunft weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als heute in der sächsischen Verwaltung beschäftigen können. Die staatlichen Aufgaben und vor allem deren Komplexität werden aber nicht in gleichem Maße oder zumindest nicht mit ähnlicher Geschwindigkeit abnehmen. Dieser drohenden Lücke kann aus Sicht der Sächsischen Staatsregierung nur mit einer Straffung von Strukturen, der Optimierung von Abläufen und vor allem durch einen passgenauen Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien entgegengewirkt werden.“ Drei konkrete Handlungsfelder werden in dem Papier genannt: ebenenübergreifendes Prozess-Management, Bürger-Terminals und E-Partizipation.
Prozesse ebenenübergreifend managen
Die Erkenntnis, dass ein ebenenübergreifendes Handeln künftig immer gefragter sein wird und die Kunden stärker im Zentrum der Betrachtung stehen müssen, setzt sich immer mehr durch. Kein Geheimnis ist auch, dass der neue Blick auf das Verwaltungshandeln, das sich von hierarchischen zugunsten ergebnisorientierter Strukturen verabschiedet, ein gewaltiges Umdenken und ein gehöriges Maß an Beharrlichkeit auf allen Führungsebenen erfordert. Die Problematik ist erkannt, konstatiert das Positionspapier, und es gebe auch bereits Projekte auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, die sich mit ebenenübergreifendem Prozess-Management befassen. Was fehlt, ist die Verzahnung dieser Aktivitäten. Außerdem heißt es in dem Papier, dass viele Projekte zu sehr aus Sicht der Verwaltung angelegt und optimiert sowie unter einem stark juristischen Fokus betrieben wurden. Da die Reaktionsgeschwindigkeit der Rechtsetzung mit der technischen Entwicklung häufig nicht mithalte, würden Effizienzpotenziale nicht ausgeschöpft.
10 Maßnahmen notwendig
Auf Basis der Erfahrungen und Zielsetzungen wird in einem 10-Punkte-Katalog dargestellt, wie Verwaltungsanliegen von Bürgern und Wirtschaft einfacher, schneller und unkomplizierter bearbeitet werden können. So sollen beispielsweise Kooperationen intensiviert werden. Ausdrücklich wird erwähnt, dass die Arbeitsgruppe Regionales E-Government über den Nationalen IT-Gipfel hinaus in geeigneter Form weitergeführt werden soll, um im Sinne des Anliegens weitere konkrete Vorschläge zu erarbeiten. Zudem wird vorgeschlagen, ebenenübergreifendes Prozess-Management als Schwerpunktthema des nächsten IT-Gipfels der Bundesregierung aufzunehmen. Des Weiteren gelte es, die Standardisierung und Harmonisierung voranzutreiben und Transparenz herzustellen, indem beispielsweise Prozesswissen aus den verschiedenen Aktionsfeldern der breiten Verwaltungsöffentlichkeit auch ebenenübergreifend bereitgestellt werde. Darüber hinaus werden Konzeption und Aufbau eines Prozessatlasses vorgeschlagen sowie eine Anpassung des Rechtsrahmens gefordert. Die zu schaffenden E-Government-Gesetze sollten für eine Reduzierung von Schriftformerfordernissen, persönlichen Vorsprachen und Prüfanforderungen, die Straffung von Zuständigkeiten sowie die Reduzierung von Mitwirkungs- und Informationspflichten sorgen. Zudem seien Regelungen zu schaffen, um die elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren zu erlauben. Ein weiterer Punkt sind der Aufbau von Shared Service Centern sowie der zentrale Betrieb der IT bei dezentraler Nutzung. Als eigener Punkt wird das Lernen von Best Practices angeführt. In dem Papier heißt es wörtlich: „Experimentieren muss erlaubt sein. Kritischer Vergleich ist notwendig. Aus den effektivsten und kreativsten Ansätzen kann gelernt werden.“
Aus Sicht der Regionalen Arbeitsgruppe E-Government bildet die Einführung eines Prozess-Lebenszyklus durch die Etablierung eines Prozess-Managements die Grundlage, Potenziale für die Verwaltungsmodernisierung zu sichten und zu identifizieren. Bereits gestartete Projekte sollten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit weiterentwickelt werden. Künftige E-Government-Projekte werde die Verwaltung vor allem unter dem Aspekt der Interoperabilität und Nachhaltigkeit aufsetzen.
Auf unterschiedlichen Kanälen erreichbar
Als zweite Antwort auf die Herausforderungen im Zuge des demografischen Wandels stellt das Positionspapier das Bürger-Terminal vor. Der Freistaat Sachsen rechnet bis zum Jahr 2020 mit einem Bevölkerungsrückgang von 20 Prozent seiner ehemals fünf Millionen Einwohner. Die Bevölkerungsdichte in manchen Regionen des Landes wird sich gar halbieren. Da die Daseinsvorsorge jedoch auch in Zukunft gewährleistet sein muss, setzen die Länder Mitteldeutschlands auf eine intelligent integrierte Multikanalstrategie, welche den Bürgern neben dem persönlichen Vorsprechen weitere Zugangswege eröffnen soll: telefonisch, elektronisch oder mittels mobiler Bürgerservices. Diese Angebote werden künftig jedoch nicht mehr ausreichen, sind die Verfasser des Positionspapiers überzeugt. Es seien der Ausbau bestehender Angebote und weitere, unterstützende Möglichkeiten vonnöten, weil die Verwaltung schon heute nicht mehr in der Lage sei, in dünn besiedelten Regionen in derselben Weise wie in der Vergangenheit präsent zu sein. Es werden Überlegungen angestellt, neben dem Aufbau elektronischer Abwicklungsmöglichkeiten mobile Bürgerservices anzubieten sowie audiovisuelle Terminals im ländlichen Raum aufzustellen: die Bürger-Terminals. Vorbild ist hierbei Frankreich.
Service am Terminal
Die Bürger-Terminals sind mit Bildschirm, Kamera, Mikrofon, Kartenlesegerät für den neuen Personalausweis (nPA), EC-, Kredit- und Signaturkarte, Scanner und Drucker ausgestattet und können beispielsweise in Banken, Tankstellen, Geschäften oder Ärztehäusern aufgebaut werden. Via Videokonferenz wird der Kontakt zum Mitarbeiter in einem Service-Center hergestellt. Der Bürger kann sich bei Bedarf mit dem nPA authentifizieren. Werden für den Verwaltungsvorgang Dokumente benötigt, legt der Bürger diese auf den Scanner, der von dem Service-Center-Mitarbeiter aus der Ferne bedient wird, sodass ihm die eingescannten Dokumente auf seinem Bildschirm für weitere Verfahrensschritte zur Verfügung stehen. Die Anträge werden gemeinsam ausgefüllt. Der Bürger kann deren Bearbeitung durch den Service-Center-Mitarbeiter über einen geteilten Bildschirm verfolgen und steuern. Gebühren können am Terminal mit EC- oder Kreditkarte bezahlt werden. Zum Abschluss des Prozesses gibt der Mitarbeiter im Idealfall den Bescheid über den Drucker am Terminal aus. Bei komplexeren Anliegen, die eine Übergabe an zuständige Behörden erfordern, wird ein Termin genannt, bis zu dem der Bürger den Bescheid per Post erhält.
Ausgangspunkt für die Umsetzung der Bürger-Terminals ist ein Service-Center, dessen stufenweiser Aufbau in dem Positionspapier beschrieben wird. Die Basiskomponenten für die IT-Unterstützung des Service-Centers seien vorhanden, Ergänzungen jedoch erforderlich. Die audiovisuellen Bürger-Terminals könnten auch von anderen Anbietern wie Krankenkassen, Versorgern oder Banken und Versicherungen genutzt werden. In Frankreich sind derzeit mehr als 500 solcher Terminals im ländlichen Raum aufgestellt mit einem breiten Anwendungsspektrum, etwa im Bereich Krankenversicherungen, Strom-, Gas- und Wasserversorgung und Gerichtsdienstleistungen, heißt es in dem Positionspapier. Die Fallzahlen hätten sich von 550 im Jahr 2006 auf über 4.500 im Jahr 2008 erhöht. Die Erfahrungen des Nachbarlandes zeigten, dass Neugier und Freude am schnellen Kontakt mit der Verwaltung schwerer wögen als Skepsis, Zurückhaltung und Ablehnung gegenüber der technischen Neuerung.
Bürger beteiligen
Als Einsatzmöglichkeiten für die Bürger-Terminals werden in dem Positionspapier neben Auskünften über Verwaltungsleistungen und der Abwicklung von Verwaltungsverfahren auch Online-Wahlen und Bürgerpartizipation genannt. Die elektronische Bürgerbeteiligung wird zudem als drittes Handlungsfeld einer bürgernahen Verwaltung identifiziert. Sie sorge für einen besseren Austausch von Informationen und Meinungen zu politischen und strategischen Themen. Zudem könnten Anliegen über Online-Beteiligungsplattformen auf einfache Art und Weise an die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung herangetragen werden. Durch eine intelligente Verzahnung von Online- und Offline-Verfahren werde einer digitalen Spaltung vorgebeugt. Die Verfasser des Positionspapiers erachten es als sinnvoll, eine Plattform zu implementieren, die vorhandene Technologien integriert und für verschiedene Beteiligungsverfahren in unterschiedlicher Ausgestaltung verwendet werden kann. Dies lasse sich natürlich nur schrittweise umsetzen. Als erster Praxistest bietet sich dem Positionspapier zufolge die elektronische Unterstützung des Beteiligungsverfahrens zur Weiterentwicklung des Landesentwicklungsplanes an.
Auch zu dem Positionspapier ist eine Rückmeldung der Bürger erwünscht. Sachsen-CIO Wilfried Bernhardt hat die Broschüre als Beitrag zu einem dynamischen Prozess bezeichnet. Anspruch des Positionspapiers sei es, den erreichten Erörterungsstand zu dokumentieren und in der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen.
http://www.egovernment.sachsen.de
Offenbach: Neue Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten
[04.02.2026] Die Offenbacher Mitreden-Plattform wartet mit neuen Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten auf. Eine Vorhabenliste zeigt nun aktuelle städtische Projekte und gegebenenfalls die Beteiligungsmöglichkeiten an. Auch können die Bürgerinnen und Bürger eigene Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt einreichen. mehr...
MACH: Digital unterstützter Bürgerhaushalt
[15.01.2026] Mit einer Plattform unterstützt das Unternehmen MACH Kommunen bei der Durchführung von Bürgerhaushalten. Die Plattform ist eng mit der MACH Finanzsoftware verzahnt. Der Bürgerhaushalt wird somit nicht als isoliertes Beteiligungsprojekt umgesetzt, sondern direkt in die bestehende Haushalts- und Finanzplanung integriert. mehr...
Konstanz: Themen für Bürgerrat vorschlagen
[06.01.2026] Über eine Onlineplattform können die Konstanzerinnen und Konstanzer jetzt solche Themen vorschlagen, die ihrer Meinung nach ein Bürgerrat aufgreifen sollte. Spruchreif wird ein Vorschlag dann, wenn für ihn 800 Unterschriften außerhalb der Plattform gesammelt werden können. mehr...
Pforzheim: App-Gestaltung mit Bürgern
[17.12.2025] In die Entwicklung von Stadt-App und Informationsstelen bezieht die Stadt Pforzheim die Bevölkerung ein. Die Online-Beteiligung läuft noch bis 31. Januar. mehr...
Wuppertal: Offen und lernbereit
[15.12.2025] Die Stadt Wuppertal geht neue Wege in der E-Partizipation mit dem Ziel, eine lernende Verwaltung zu schaffen, die mit jedem Beteiligungsprozess besser wird. Im Zentrum der Wuppertaler Beteiligungslandschaft steht die Plattform talbeteiligung.de. mehr...
Frankfurt am Main: Neue Funktionen stärken ffm.de
[09.12.2025] Mit Mehrsprachigkeit, Einblicken in die Stadtpolitik und einer Vorhabenliste bietet das Beteiligungsportal der Stadt Frankfurt am Main mehrere neue Funktionen an. Sie sollen den digitalen Bürgerservice erweitern und eine inklusive, transparente und verständliche Beteiligungskultur stärken. mehr...
Bürgerbeteiligung: Beispielhaft gute Partizipation
[05.12.2025] Mit der Auszeichnung „Gute Bürgerbeteiligung“ würdigt das Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung alljährlich Projekte öffentlicher Träger, die innovative und qualitätsvolle Partizipationsformen erproben und erfolgreich umsetzen. Nun stehen die fünf Siegerkommunen für 2025 fest. mehr...
Bergkamen: Mehrsprachige Onlinebeteiligung
[04.12.2025] Die Stadt Bergkamen hat im Zuge ihrer Leitbildentwicklung eine mehrsprachige Onlinebeteiligungsplattform gestartet – die erste, welche das Unternehmen wer denkt was mit einem eigenen KI-Übersetzungstool umgesetzt hat. mehr...
Alpenrod: Bürgerbeteiligung per App
[12.11.2025] In der Kategorie „Innovativste Bürgerpartizipation“ ist die Orts.App der Gemeinde Alpenrod gewürdigt worden. mehr...
Kreis Stade: Umfassende Onlineumfrage
[04.11.2025] Der Kreis Stade will seine Angebote noch besser an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ausrichten. Mit diesem Ziel hat er eine anonyme Onlineumfrage gestartet. Es ist die bislang umfassendste Umfrage des Landkreises. mehr...
Frankfurt am Main: Frankfurt beteiligt sich
[30.10.2025] Die Beteiligungsplattform „Frankfurt fragt mich“ zeigt konkrete Erfolge: Die Ideen aus der Bevölkerung gestalten die Mainmetropole. Online werden die erfolgreich umgesetzten Bürgerideen vorgestellt. mehr...
Frankfurt am Main: Werbung für Bürgerbeteiligung
[27.10.2025] Die Stadt Frankfurt am Main wirbt mit einer Social-Media- und Plakatkampagne für Bürgerbeteiligung in der Mainmetropole. Hierfür konnten prominente Frankfurterinnen und Frankfurter gewonnen werden. mehr...
Hochschulallianz Ruhr: Weiterbildungsangebot für Kommunen
[23.10.2025] Mit einem Kurs zu digitalen Partizipationsformaten reagiert die Hochschulallianz Ruhr auf die hohe Weiterbildungsnachfrage von Kommunen. Der Kurs ist auf die kommunale Praxis ausgerichtet. Er steht allen Mitarbeitenden offen, unabhängig von formalen Bildungsabschlüssen. mehr...
Arnsberg: Onlineumfrage zur Digitalisierungsstrategie
[15.10.2025] Die Stadtverwaltung Arnsberg möchte ihre Dienstleistungen einfacher, schneller und bürgerfreundlicher machen. Wie das aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger gelingen kann, will die Kommune in einer Onlineumfrage herausfinden. mehr...
Lich: Bürgerbeteiligung geht online
[16.09.2025] Mit der Charta für Bürgerbeteiligung und dem Beteiligungsbeirat hat die Stadt Lich in den vergangenen Jahren wichtige Grundlagen für die Bürgerbeteiligung geschaffen. Mit einer Onlineplattform geht sie nun den nächsten Schritt. mehr...