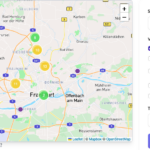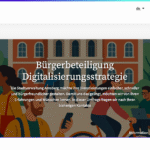E-PartizipationErweiterter Raum
Mit dem Internet erweitert sich der Raum der kommunikativen Möglichkeiten – auch für die Politik. Damit stellt sich die Frage, wie sich die politische Kommunikation in einer von Online-Medien geprägten Welt verändert. Der Schlüssel zu einer Antwort liegt in der individuellen politischen Kommunikation. Entscheidend ist, wie Bürger und Vertreter der Politik in ihren unterschiedlichen Rollen den erweiterten Raum nutzen. Ihr Verhalten ist allerdings nicht steuer- und nur sehr begrenzt voraussagbar. Vor diesem Hintergrund ist zu hinterfragen, wie sich die Teilnehmer über politische Themen informieren, wie sie sich darüber mit anderen austauschen und in welcher Form sie ihre Meinung öffentlich machen, um auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen.
Studie erlaubt Typenbildung
Besonders aufschlussreich für die Beantwortung der Frage ist ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur politischen Online-Kommunikation: In einer Langzeitstudie wurde eine repräsentative Stichprobe der deutschen Bevölkerung von 2002 bis 2009 jährlich nach ihren politischen Kommunikationsaktivitäten befragt – von der Zeitungslektüre bis hin zur Unterschrift elektronischer Petitionen. In diesen Zeitraum fallen die hohen Zuwachsraten bei der Internet-Nutzerschaft. Die Daten zeigen also, wie sich die Mehrheit der Bevölkerung das Web zu eigen macht und welche Folgen dies für sie hatte. Die Daten erlauben es auch, Typen zu bilden – also Gruppen von Bürgern, die sich in ihren politischen Kommunikationsaktivitäten ähneln.
Schweigende Mehrheit
Hauptergebnis ist, dass etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung um jegliche politische Kommunikation einen weiten Bogen macht. Diese so genannte schweigende Mehrheit umfasst Personen, die wenig Interesse am politischen Teil der Tageszeitung haben, welche die Tagesschau nebenbei verfolgen und die Nachrichten im Auto mit halbem Ohr hören. Sie unterhalten sich auch nicht mit Kollegen, Verwandten oder Freunden über Politik. Die Gründe für diese Distanz sind vielfältig und reichen von nicht gelernt über verlernt und nicht davon überzeugt, dass die Bürger politisch etwas bewegen können bis hin zu Schwierigkeiten, die Komplexität der Probleme zu reduzieren. Dieser schweigenden Mehrheit ist anderes wichtiger, etwa Gesundheit, Familie, Nachbarschaft, Arbeitsbedingungen, Urlaub und Geld. Für diese 50 Prozent haben die veränderten Rahmenbedingung für die politische Kommunikation durch Online-Medien so gut wie keine Bedeutung. In diesem Segment gibt es keinerlei Anzeichen für eine politische Mobilisierung durch das Netz.
Ein weiteres gutes Drittel der Bevölkerung ist stärker politisch interessiert und unterschiedlich aktiv. Die dieser Gruppe zugehörigen Bürger haben ihre jeweils eigenen Verhaltensweisen herausgebildet und können in eigennützige Interessenvertreter, traditionell Engagierte sowie organisierte Extrovertierte untergliedert werden. Auch an deren politischer Kommunikation verändern die Online-Medien wenig.
Digital Citizens
Und dann gibt es ein weiteres Sechstel, die so genannten Digital Citizens. Ihr herausstechendes Merkmal ist die Nutzung der Online-Möglichkeiten für politische Kommunikationszwecke. Die Digital Citizens haben sich zu Beginn der 2000er-Jahre herausgebildet und sind mittlerweile eine Gruppe von Bedeutung. Sie sind der Teil der so genannten Digital Natives, der das Netz auch für politische Kommunikationsaktivitäten nutzt. Die Angehörigen dieser Gruppe meiden traditionelle politische Aktivitäten wie Versammlungsbesuche oder Leserbriefe und vollziehen ihre politische Information, Diskussion und Partizipation weitgehend auf Online-Medien. Mittlerweile können sie alle Aktivitäten über ihre Smartphones integrieren. Diese Gruppe von inzwischen elf Millionen Bundesbürgern bildet ihre eigenen Verhaltensweisen aus und bettet das Politische in ihre Online-Welt ein. Hier entsteht ein neues Elitensegment. Die Mitglieder dieser Gruppe sind in der Regel jung, gebildet und ihre Verhältnisse noch wenig gesichert. Sie sind – in Korrelation zum vergleichsweise hohen Bildungsgrad – überdurchschnittlich politisch interessiert, von der politischen Wirksamkeit ihres eigenen Handelns stark überzeugt und auch deswegen überdurchschnittlich zufrieden mit dem politischen System und mehr an Freiheit als an Gleichheit und Sicherheit orientiert. Das Alter ist der Schlüssel zu ihrem Verhalten, weil sie erst in geringem Maße feste Gewohnheiten ausgebildet haben. Die Gewohnheiten der Digital Citizens entstehen erst aus und mit dem Netz und unterscheiden sich von überkommenen Kommunikationsformen. Angehörige dieser Gruppe werden mit der Zeit in gesellschaftliche Schlüsselpositionen hineinwachsen und mehr und mehr die politische Kommunikation prägen.
Überraschende Sprünge
Die Digital Citizens werden sich mit dem Älterwerden nicht mehr an traditionelle Formen der Kommunikation gewöhnen. Zwar werden auch sie ihre Kommunikationsweisen verändern, allerdings vollziehen sie diese Veränderungen in Anlehnung an das Internet und dessen Weiterentwicklung.
In den vergangenen 15 Jahren haben sich immer wieder überraschende Sprünge ergeben, die aus der Innovationskultur der Digital Natives entstanden sind. Und wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung. Das führt dazu, dass etablierte mediale und politische Organisationen sowie etwa Journalisten, PR-Verantwortliche und Berufspolitiker dazulernen müssen, wenn sie den Anschluss an die Online-Welt nicht verlieren wollen. Das bleibt nicht ohne politische Folgen: In einem demokratischen Kontext bedürfen kollektiv bindende Entscheidungen einer öffentlich erörterbaren Legitimität. Aus diesem Grund sind die Kommunikation und die Veränderungen ihres Kontextes von zentraler Bedeutung für die Politik.
Halle (Saale): Kartenbasierte Bürgerbeteiligung
[12.02.2026] Die Stadt Halle (Saale) führt nun die erste interaktive, digitale Bürgerbeteiligung über die 3D-Software HAL-Plan durch. Bis zum 13. März stehen hier interaktive Themenkarten zum geplanten neuen Flächennutzungsplan der Kommune zur Verfügung. Dank eines sogenannten Storymoduls können die Rückmeldungen dazu direkt in die Karten eingetragen werden. mehr...
Offenbach: Neue Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten
[04.02.2026] Die Offenbacher Mitreden-Plattform wartet mit neuen Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten auf. Eine Vorhabenliste zeigt nun aktuelle städtische Projekte und gegebenenfalls die Beteiligungsmöglichkeiten an. Auch können die Bürgerinnen und Bürger eigene Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt einreichen. mehr...
MACH: Digital unterstützter Bürgerhaushalt
[15.01.2026] Mit einer Plattform unterstützt das Unternehmen MACH Kommunen bei der Durchführung von Bürgerhaushalten. Die Plattform ist eng mit der MACH Finanzsoftware verzahnt. Der Bürgerhaushalt wird somit nicht als isoliertes Beteiligungsprojekt umgesetzt, sondern direkt in die bestehende Haushalts- und Finanzplanung integriert. mehr...
Konstanz: Themen für Bürgerrat vorschlagen
[06.01.2026] Über eine Onlineplattform können die Konstanzerinnen und Konstanzer jetzt solche Themen vorschlagen, die ihrer Meinung nach ein Bürgerrat aufgreifen sollte. Spruchreif wird ein Vorschlag dann, wenn für ihn 800 Unterschriften außerhalb der Plattform gesammelt werden können. mehr...
Pforzheim: App-Gestaltung mit Bürgern
[17.12.2025] In die Entwicklung von Stadt-App und Informationsstelen bezieht die Stadt Pforzheim die Bevölkerung ein. Die Online-Beteiligung läuft noch bis 31. Januar. mehr...
Wuppertal: Offen und lernbereit
[15.12.2025] Die Stadt Wuppertal geht neue Wege in der E-Partizipation mit dem Ziel, eine lernende Verwaltung zu schaffen, die mit jedem Beteiligungsprozess besser wird. Im Zentrum der Wuppertaler Beteiligungslandschaft steht die Plattform talbeteiligung.de. mehr...
Frankfurt am Main: Neue Funktionen stärken ffm.de
[09.12.2025] Mit Mehrsprachigkeit, Einblicken in die Stadtpolitik und einer Vorhabenliste bietet das Beteiligungsportal der Stadt Frankfurt am Main mehrere neue Funktionen an. Sie sollen den digitalen Bürgerservice erweitern und eine inklusive, transparente und verständliche Beteiligungskultur stärken. mehr...
Bürgerbeteiligung: Beispielhaft gute Partizipation
[05.12.2025] Mit der Auszeichnung „Gute Bürgerbeteiligung“ würdigt das Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung alljährlich Projekte öffentlicher Träger, die innovative und qualitätsvolle Partizipationsformen erproben und erfolgreich umsetzen. Nun stehen die fünf Siegerkommunen für 2025 fest. mehr...
Bergkamen: Mehrsprachige Onlinebeteiligung
[04.12.2025] Die Stadt Bergkamen hat im Zuge ihrer Leitbildentwicklung eine mehrsprachige Onlinebeteiligungsplattform gestartet – die erste, welche das Unternehmen wer denkt was mit einem eigenen KI-Übersetzungstool umgesetzt hat. mehr...
Alpenrod: Bürgerbeteiligung per App
[12.11.2025] In der Kategorie „Innovativste Bürgerpartizipation“ ist die Orts.App der Gemeinde Alpenrod gewürdigt worden. mehr...
Kreis Stade: Umfassende Onlineumfrage
[04.11.2025] Der Kreis Stade will seine Angebote noch besser an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ausrichten. Mit diesem Ziel hat er eine anonyme Onlineumfrage gestartet. Es ist die bislang umfassendste Umfrage des Landkreises. mehr...
Frankfurt am Main: Frankfurt beteiligt sich
[30.10.2025] Die Beteiligungsplattform „Frankfurt fragt mich“ zeigt konkrete Erfolge: Die Ideen aus der Bevölkerung gestalten die Mainmetropole. Online werden die erfolgreich umgesetzten Bürgerideen vorgestellt. mehr...
Frankfurt am Main: Werbung für Bürgerbeteiligung
[27.10.2025] Die Stadt Frankfurt am Main wirbt mit einer Social-Media- und Plakatkampagne für Bürgerbeteiligung in der Mainmetropole. Hierfür konnten prominente Frankfurterinnen und Frankfurter gewonnen werden. mehr...
Hochschulallianz Ruhr: Weiterbildungsangebot für Kommunen
[23.10.2025] Mit einem Kurs zu digitalen Partizipationsformaten reagiert die Hochschulallianz Ruhr auf die hohe Weiterbildungsnachfrage von Kommunen. Der Kurs ist auf die kommunale Praxis ausgerichtet. Er steht allen Mitarbeitenden offen, unabhängig von formalen Bildungsabschlüssen. mehr...
Arnsberg: Onlineumfrage zur Digitalisierungsstrategie
[15.10.2025] Die Stadtverwaltung Arnsberg möchte ihre Dienstleistungen einfacher, schneller und bürgerfreundlicher machen. Wie das aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger gelingen kann, will die Kommune in einer Onlineumfrage herausfinden. mehr...