DigitalisierungNeu denken und handeln
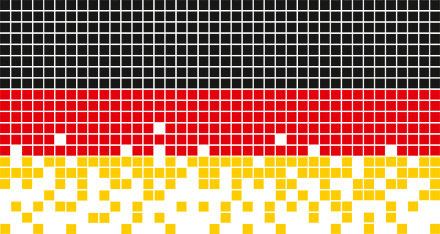
Die öffentliche Verwaltung muss aufholen, um digital mitzugestalten.
(Bildquelle: PEAK Agentur für Kommunikation)
Bahnbrechende Fortschritte bei digitalen Angeboten staatlicher Stellen hat es in Deutschland in jüngster Zeit kaum gegeben. Das haben auch die Bürger erkannt und nutzen die aktuellen Offerten nur wenig. Laut dem eGovernment MONITOR 2017 ist die Nutzung hierzulande sogar von 45 Prozent im Jahr 2012 auf jetzt 41 Prozent gesunken. Die Wirtschaftsmacht Deutschland scheint im hinteren Teil der Vergleichsskalen festzuhängen. Alle Akteure sind sich einig wie noch nie: Es muss etwas geschehen.
Bund und IT-Planungsrat stellen den Portalverbund als wichtigen Baustein der Digitalisierung heraus. Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) sollen alle Verwaltungsleistungen binnen fünf Jahren digitalisiert werden. Das richtige Motto für ein Gelingen des Plans wäre: „Keiner kann und macht es mehr alleine – gemeinsam schaffen wir es besser“. Nur wenn Verwaltungen auf allen Ebenen, Politik und Wirtschaft gemeinsam agieren, wird sich zeitgemäßes E-Government etablieren lassen.
Der Wirtschaft mag der Portalverbund beim Datenaustausch mit der Verwaltung helfen. Die Ergebnisse des eGovernment MONITOR 2017 lassen allerdings Zweifel aufkommen, ob dieser Weg auch für die Bevölkerung relevant ist. 67 Prozent der 18- bis 34-Jährigen greifen über Suchmaschinen auf Verwaltungsportale zu, ebenso 49 Prozent der 35- bis 54-Jährigen. Die über 55-Jährigen dagegen besuchen die jeweilige Verwaltung am häufigsten direkt über deren Web-Seite. Für die lange Zukunft gebaut, ist der Portalverbund selbst deshalb möglicherweise eine Innovation an der Lebenspraxis vorbei.
Persönliches Erscheinen entbehrlich machen
Wichtig ist mit Blick auf die Digitalisierung auch die vorgesehene Schaffung einer eindeutigen elektronischen Identifizierung der Bürger, die von allen Verwaltungen akzeptiert wird. Solche Identitäten kennen die Bürger längst als Kunden von Banken oder Verkaufsportalen. Statt die Privatwirtschaft aufzufordern, seine digitale Identität ebenfalls zu akzeptieren, könnte ein kooperierender Staat beispielsweise auch die von Banken überprüften digitalen Identitäten anerkennen. Für den Nutzer hätte das den Vorteil, dass er eine bereits vorhandene digitale Identität anderweitig nutzen kann und sich nicht an eine zusätzliche gewöhnen muss – zumal der Bürger aller Erfahrung nach im Vergleich eher selten Verwaltungskontakt hat. Eigentlich sollte es doch das Ziel sein, den Bedarf an Verwaltungskontakten zu verringern und nicht auszubauen.
Mit digitalen Transaktionen soll das persönliche Erscheinen der Bürger entbehrlich gemacht werden. Hierfür sind Vorschriften zu ändern, die den Gang zum Amt derzeit noch explizit vorsehen. Dazu gehört die Abschaffung der Schriftform und der papiergebundenen Nachweispflichten. Solche Schriftformerfordernisse behindern die Digitalisierung von Leistungsprozessen in der Verwaltung. Hier könnte eine regulierte Disruption helfen – etwa so: Per Gesetz werden alle vorgesehenen Schriftformerfordernisse und Nachweispflichten drei Jahre nach Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes abgeschafft. Jeder, der die Schriftform für seine Arbeit als unabdingbar einschätzt, muss sich dann auf den Weg der Gesetzgebung machen und überzeugend begründen, warum sie in diesem konkreten Fall notwendig ist.
Vernetzen gegen Zersplitterung
Der Normenkontrollrat (NKR) hat die starke Zersplitterung von Verwaltungsregistern und deren schlechten Zustand als Grund für das langsame Vorankommen der Digitalisierung in Deutschland benannt. Ob für die Registermodernisierung eine zentrale Infrastruktur erforderlich ist oder ob der dezentral föderalistische Charakter der gegenwärtigen Register beibehalten werden soll, lässt der NKR offen. In Österreich hat die Registerzentralisierung mehr als zehn Jahre gedauert. So viel Zeit haben wir nicht. Deshalb sollte der in einem Gutachten der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, Vitako, vorgeschlagene Weg gegangen und die Interoperabilität und Vernetzung der vorhandenen dezentral betriebenen Register verbessert werden. Und das getreu der in dem Gutachten richtig ausgedrückten Feststellung: „Was nicht kaputt ist, sollte man nicht reparieren.“
Für eine Verwaltung, die das Credo „people first“ ernst nimmt, ist eine Veränderung im Denken und Handeln der Beschäftigten notwendig. Bisher galt: „Wer etwas von mir will, muss vorsprechen.“ Zeitgemäß wäre: „Wir wissen, was dem Bürger zusteht und werden proaktiv auf ihn zugehen.“ Dafür müssen die vorhandenen Silos überwunden werden – hin zu einer datenbasierten vernetzten Verwaltung. Wissen, das man in Silos schützen konnte, ist heute nicht mehr papiergebunden und sucht sich eigene Wege. Viele Verwaltungsentscheidungen sind in der digitalen Zeit nicht auf reines Verwaltungswissen begründet. Denn auch dort arbeitet jeder mit Suchmaschinen.
Prinzipien von heute
Gleichzeitig stiften längst Algorithmen einen Nutzen, den kaum noch jemand missen möchte. Ohne solche Algorithmen werden auch die Prozesse einer modernen Verwaltung nicht effizient funktionieren. Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass diese Entwicklung zu der Verantwortungsorganisation passt. Verwaltung und Wissenschaft müssen gemeinsam Vorschläge entwickeln, wie eine Organisation aufzubauen ist, die Algorithmen überprüfen kann. Sie muss für deren Transparenz stehen und eingreifen können. Notwendig ist außerdem eine starke Vollzugskompetenz, die eingreift, wenn sich etwas in eine ungewollte Richtung entwickelt.
Ändern müsste sich auch, was mit Führung in der Verwaltung zu überschreiben ist. „Wissen ist Macht“ skizziert ein Führungsprinzip von gestern. Heute kommt es darauf an, Wissen zu teilen. Die Zeiten des so genannten information hiding sind vorbei. Statt Besserwisser sein zu wollen, zeichnen sich erfolgreiche Führungskräfte heute dadurch aus, dass die Mitarbeiter ein gemeinsames Ergebnis in der Zusammenarbeit mit anderen erzielen. Das erfordert ein nachhaltiges Umdenken. An dieser Stelle ist ein Projekt erwähnenswert, das sich im Rahmen der vom Bundesarbeitsministerium unterstützten Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ mit der Führungsaufgabe in der Verwaltung beschäftigt: In Pilotprojekten wird versucht, trotz verschiedener Interessen – von der Mitbestimmungsseite über die Arbeits- und Führungsebene – Wege zu guter Führung und Zusammenarbeit zu finden.
Digital mitgestalten
Zu Führung und Wissen gesellt sich ein weiterer wichtiger Punkt: Kundschaft, die auf Verwaltung trifft. Diese Kundschaft ist auf jeden Fall pseudo-wissender als früher. Auch das ist ein Phänomen, das der herkömmlichen Verwaltung nur partiell bekannt ist. Und es ist nicht einfach, sich mit einer kompetenten Kundschaft auseinanderzusetzen.
Schon die Lösung jeder einzelnen Aufgabe für sich auf dem Weg hin zu modernem E-Government ist kompliziert. Manche der notwendigen Veränderungen werden erst nach zehn Jahren abgeschlossen sein. Aber es hilft nichts: Die deutsche Verwaltung muss endlich aufholen, sodass sie das digitale Zeitalter mitgestalten kann. Dabei braucht sie auch die Unterstützung der Politik.
Potsdam: Neuer Digitalisierungsrat
[19.01.2026] In Potsdam hat sich der zweite Digitalisierungsrat der Stadt konstituiert. Er soll in den kommenden drei Jahren den digitalen Wandel der brandenburgischen Landeshauptstadt begleiten und bringt dafür Expertise aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein. mehr...
Saarland: Dritte Auflage des E-Government-Pakts
[08.01.2026] Das Saarland und die Kommunen haben die dritte Auflage ihres E-Government-Pakts unterzeichnet. Das Land wird demnach die Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und beim Ausbau digitaler Angebote unterstützen. Ein gemeinsames IT-Steuerungsgremium wird die vereinbarten Maßnahmen begleiten. mehr...
GovTech Kommunal: Kommunen digital handlungsfähig machen
[18.12.2025] Die Initiative GovTech Deutschland hat ihr Angebot um den Verein GovTech Kommunal erweitert. Es soll damit eine bundesweite Einheit geschaffen werden, welche die kommunale Digitalisierung systematisch bündelt und konsequent an den Bedarfen der Städte, Gemeinden und Landkreise ausrichtet. Die Mitgliedschaft steht mit gestaffeltem Beitragsmodell allen Kommunen offen. mehr...
Hanau: Stadtweite IT neu ausgerichtet
[18.12.2025] Hanau hat sich das Ziel gesteckt, bis 2030 die Digitalisierung der gesamten „Unternehmung Stadt“ abzuschließen. Dazu werden Entscheidungs-, Verantwortungs- und Budgetstrukturen künftig an einer Stelle gebündelt, zudem soll die Stelle des CDO geschaffen werden. mehr...
Deutscher Landkreistag: Kommunen in Modernisierungsagenda einbinden
[11.12.2025] Die von Bund und Ländern vereinbarte föderale Modernisierungsagenda bewertet der Deutsche Landkreistag (DLT) als positiv. Damit Bürger, Unternehmen und Kommunen jedoch tatsächlich entlastet werden, ist ein enger Schulterschluss mit Landkreisen, Städten und Gemeinden bei der Umsetzung erforderlich. mehr...
Sachsen-Anhalt: Zentrale Serviceagentur für Kommunen
[08.12.2025] Eine Machbarkeitsstudie aus Sachsen-Anhalt zeigt, dass eine zentrale Serviceagentur für Kommunen Verwaltungsabläufe beschleunigen und verbessern kann. Digitalministerin Lydia Hüskens kündigte an, dass ab 2026 sukzessive eine Unterstützungseinheit für Kommunen umgesetzt werden soll. mehr...
IT-Planungsrat: Kommunalbeirat NOOTS
[08.12.2025] Das Kommunalgremium des IT-Planungsrats übernimmt im Zuge der Neuaufstellung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) zusätzlich die Rolle des Kommunalbeirats NOOTS. Es hat dabei keine Entscheidungsbefugnis, sondern erfüllt eine Resonanz- und Feedbackfunktion. mehr...
4. Digitalministerkonferenz: Bessere Zusammenarbeit aller Ebenen
[27.11.2025] Bei der 4. Digitalministerkonferenz in Berlin setzte Niedersachsens Digitalministerin Daniela Behrens den Schwerpunkt auf föderale Zusammenarbeit: Sie forderte eine engere, effektivere Zusammenarbeit aller föderaler Ebenen und den Zugang zu Services des ITZBund auch für Länder und Kommunen. mehr...
Oldenburg: Mit neuem Amt in die digitale Zukunft
[27.11.2025] Alle Aufgaben rund um digitale Verwaltungsprozesse und die IT-Infrastruktur bündelt die Stadt Oldenburg ab Anfang kommenden Jahres in einem eigenen Amt für digitale Transformation. Das soll Abstimmungsaufwände reduzieren, Prozesse beschleunigen und dauerhaft zu innovativen, bürgernahen Angeboten beitragen. mehr...
Föderale Modernisierungsagenda: Jetzt muss gehandelt werden
[27.11.2025] Der Nationale Normenkontrollrat mahnt die in der Föderalen Modernisierungsagenda vorgesehene bessere Aufgabenbündelung mit Nachdruck an. Die Ministerien müssten dieses Projekt konsequent weiterverfolgen, um Effizienz und Entlastung der Kommunen zu sichern. mehr...
Vitako: 20 Jahre Austausch und Innovation
[11.11.2025] Seit zwei Jahrzehnten vertritt Vitako die Interessen der kommunalen IT-Dienstleister. Bei der Jubiläumsfeier würdigte Digitalminister Karsten Wildberger in klaren Worten die Rolle der Kommunen als Ausgangspunkt digitaler Verwaltung und rief zu enger Zusammenarbeit mit Bund und Ländern auf. mehr...
Hamburg: Annika Busse ist die neue CIO
[11.11.2025] Annika Busse ist die neue CIO der Freien und Hansestadt Hamburg. Die bisherige stellvertretende Hamburg-CIO hat zum 1. November die Nachfolge von Jörn Riedel angetreten, der nach langjährigem Wirken in den Ruhestand verabschiedet wurde. mehr...
IT-Planungsrat: Kommunaler Input zu digitalstrategischen Themen
[23.10.2025] Der IT-Planungsrat stellt die strategischen Weichen für die Verwaltungsdigitalisierung – und bindet dabei auch Kommunen ein. Beim letzten Treffen des Kommunalgremiums ging es um die zentralen Bereitstellung von EfA-Leistungen und eine Aufgabenneuordnung zur Entlastung von Kommunen. mehr...
Bitkom-Dataverse: Datenbank zum digitalen Deutschland
[21.10.2025] Mit dem Bitkom-Dataverse soll das größte kostenlose Onlineportal mit Zahlen und Statistiken zum Digitalen Deutschland entstehen. Es umfasst Daten unter anderem aus den Bereichen Bildung, Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Verwaltung sowie Mobilität. Auch die Bitkom-Indizes wie der Länderindex oder Smart-City-Index sind enthalten. mehr...
Baden-Württemberg: Kommunen als Treiber der Entbürokratisierung
[20.10.2025] In Baden-Württemberg wurde das Kommunale Regelungsbefreiungsgesetz beschlossen. Damit erhalten Kommunen und Zweckverbände mehr Flexibilität bei der Neugestaltung und Vereinfachung von Verwaltungsverfahren. Sich bewährende Neuerungen sollen landesweit umgesetzt werden. mehr...

















