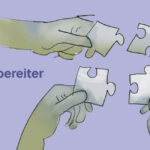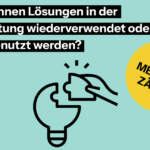Digitale TransformationSchlanke Prozesse statt Aktenberge

Viele Bürgerinnen und Bürger wollen digital mit Behörden kommunizieren, um sich Wege zu sparen und nicht an Öffnungszeiten gebunden zu sein.
(Bildquelle: Dell Technologies)
In den vergangenen Monaten hat sich die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, einkaufen und ihre Freizeit gestalten, deutlich verändert – sowohl der berufliche als auch der private Alltag sind um einiges digitaler geworden. Homeoffice, Onlineshopping und Videostreaming sind allerdings nur die sichtbarsten Ausprägungen einer neuen digitalen Selbstverständlichkeit. Selbst langjährige Digitalmuffel zücken heute geübt das Smartphone, um via QR-Code im Restaurant die Speisekarte abzurufen oder bei einer Kulturveranstaltung einzuchecken. Damit sind auch die Erwartungen an digitale Services in anderen Bereichen wie der öffentlichen Verwaltung gestiegen. Wer wie selbstverständlich mit Kolleginnen und Kollegen remote zusammenarbeitet und die Videosprechstunde dem Gang in die Praxis vorzieht, möchte nicht mehr persönlich in einer Behörde erscheinen müssen, um sich oder sein Fahrzeug umzumelden.
Nach wie vor ist Deutschland einer der Nachzügler, was die Digitalisierung des öffentlichen Sektors betrifft. Noch im Jahr 2019 übermittelte nur etwa die Hälfte der deutschen Internet-Nutzer, die Formulare bei Behörden einreichen mussten, diese online – das bedeutet den drittletzten Platz innerhalb der EU und liegt weit unter dem EU-Durchschnitt von 67 Prozent. Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) soll sich das ändern: Es verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis spätestens Ende 2022 insgesamt 575 Verwaltungsleistungen online bereitzustellen. Immerhin 315 davon waren im vergangenen November schon verfügbar, wenn auch teilweise nur in wenigen Kommunen. Die neuen Services und Lösungen werden zumeist von einzelnen Ländern entwickelt und erprobt, bevor sie bundesweit eingeführt werden. Das soll Ressourcenverschwendung verhindern und für deutschlandweit einheitliche Digitalangebote sorgen.
Die Krise als Chance
Wie schnell deutsche Behörden im Ernstfall digitalisieren können, haben sie während der Corona-Pandemie vielfach bewiesen, als sie in wenigen Tagen neue Portale für die Beantragung von Corona-Hilfen und anderen Unterstützungsgeldern aufbauten. Und das, obwohl die meisten Einrichtungen des öffentlichen Sektors mit ganz ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen hatten wie Unternehmen. Sie mussten einerseits ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten und sich technisch sowie organisatorisch auf Remote Work einstellen, andererseits geplante Digitalisierungsvorhaben weiterverfolgen und zusätzliche Projekte anstoßen, um die Nachfrage nach neuen Online-Angeboten zu bedienen.
Immerhin erlebte der Großteil der Ämter und Behörden in dieser schwierigen Situation keine Budgetkürzungen, sodass viele notwendige Maßnahmen eingeleitet werden konnten. Mittelfristig dürfte die wegen der Pandemie angespannte Finanzlage in Städten und Gemeinden, in Bundesländern und auf Bundesebene jedoch dazu führen, dass viele Haushalte konsolidiert werden und Behörden sparen müssen. Digitale Lösungen zahlen sich dann doppelt aus: Sie verbessern nicht nur die Services für die Bürger, sondern machen auch interne Abläufe effizienter und helfen so, die Kosten zu senken.
Umso wichtiger ist es für Behörden nun, ihre Digitalisierung mit Nachdruck voranzutreiben, denn die umfangreichen Konjunkturpakete, die Deutschland und die EU geschnürt haben, stellen nur für eine begrenzte Zeit zusätzliche Mittel bereit. Insgesamt 130 Milliarden Euro umfasst das deutsche Hilfspaket, mit dem die Wirtschaft in Schwung und Deutschland zukunftsfähig gemacht werden soll, und 750 Milliarden Euro das europäische. Zwischen zehn und 15 Prozent der Mittel werden hierzulande in Digitalisierungsmaßnahmen fließen, schätzen die Marktforscher von IDC – nicht ausschließlich, aber vor allem im öffentlichen Sektor. Es sei „eine der größten Chancen für die Transformation des öffentlichen Sektors seit der deutschen Wiedervereinigung“, urteilt IDC.
Neue ETHIK für Behördenservices
Trotz hoher Dringlichkeit darf die Digitalisierung von Behörden nicht überstürzt erfolgen und sollte sich auch in veränderten Arbeitsweisen und -abläufen widerspiegeln. Digitale Front Ends, hinter denen die gleichen, oft ineffizienten Prozesse wie bislang stehen, bringen die öffentliche Verwaltung nicht voran und sorgen auch bei den Bürgern nur für wenig Begeisterung. Über halbdigitale Lösungen, bei denen sie beispielsweise tagelang auf ein per Post verschicktes Passwort warten oder ihre online eingereichten Anträge erst nach Wochen manuell bearbeitet werden, haben sie sich in der Vergangenheit bereits genug geärgert. Bevor es ans Digitalisieren geht, müssen daher Abläufe überdacht, verschlankt und gegebenenfalls auch aussortiert werden, wenn sie überflüssig sind.
IDC fasst die wichtigsten Ziele der Digitalisierung des öffentlichen Sektors unter dem Schlagwort ETHIK zusammen: Die neuen digitalen Angebote und Abläufe müssten effizient, transparent, hochgradig reaktionsschnell, inklusiv und komfortabel sein. Auf diese Weise wirken sie optimal nach innen und außen. Behörden selbst können ihre Anwendungs- und Datensilos auflösen, ihr Sicherheits- und Datenschutzniveau verbessern, Mitarbeitende mit benutzerfreundlichen Anwendungen ausstatten und so insgesamt deutlich produktiver werden. Die Bürgerinnen und Bürger wiederum erhalten zuverlässige neue Online-Services und profitieren von kürzeren Bearbeitungszeiten. Die öffentliche Verwaltung, die oft als träge und teuer wahrgenommen wird, präsentiert sich fortschrittlicher und demonstriert, dass sie verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgeht. Für ihre Akzeptanz in der Bevölkerung ist das enorm wichtig, denn Untersuchungen haben gezeigt, dass die Bürger einer Behörde neunmal mehr vertrauen, wenn sie mit deren Service zufrieden sind.
Ein Portal für alle Behördenservices
Basis der Digitalisierung des öffentlichen Sektors sind hybride Infrastrukturen und offene Plattformen. Diese erlauben es Behörden, flexibel zu skalieren, reibungslos Daten auszutauschen und mit Container-Technologien moderne Anwendungen und Services aufzubauen. Gleichzeitig müssen Behörden Daten als strategische Ressource nutzen. Mit Lösungen für Big Data, künstliche Intelligenz und Machine Learning ziehen sie neue Erkenntnisse aus diesen Daten, die bessere und schnellere Entscheidungen ermöglichen und den Automatisierungsgrad erhöhen. Dabei dürfen sie allerdings Datenschutz und Datensicherheit nicht vernachlässigen. Denn zum einen rückt der öffentliche Sektor mit neuen Online-Angeboten noch stärker ins Visier von Cyber-Kriminellen, zum anderen stehen die Bürger einem allzu hemmungslosen Datenaustausch zwischen Behörden eher skeptisch gegenüber. Die große Aufgabe der öffentlichen Verwaltung wird es daher sein, neue Services zu schaffen, die sowohl hochsicher als auch einfach nutzbar sind, und Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben so fließen zu lassen, dass die Zusammenarbeit von Behörden verbessert wird und Bürger ihre Daten nicht unzählige Male eingeben müssen.
Diese Aufgabe brauchen Behörden allerdings nicht allein zu stemmen – die Mehrheit der Bürger steht einer Zusammenarbeit mit Unternehmen und Universitäten bei der Entwicklung innovativer digitaler Lösungen aufgeschlossen gegenüber. Sie wünschen sich vor allem zuverlässige und sichere Services, und dass Behörden die Nutzung dieser Services einfacher gestalten. Mehr als die Hälfte würde eigenen Angaben zufolge mehr digitale Angebote der öffentlichen Verwaltung nutzen, stünden diese gesammelt auf einem einzigen Portal bereit.
NExT-Netzwerk: Arbeit neu strukturiert
[17.02.2026] Mit einer neuen strategischen Struktur richtet der Verein NExT seine Arbeit zur Verwaltungstransformation neu aus: Künftig sollen Austausch, Analyse und politische Einordnung enger verzahnt werden. Ein Relaunch der Website macht diesen Anspruch auch nach außen sichtbar. mehr...
Schleswig-Holstein: Unterstützung für kommunale Bauleitplanung
[05.02.2026] Schleswig-Holstein will Bauleitpläne künftig mit dem Standard XPlanung und einer zentralen Bereitstellungsplattform landeseinheitlich digital verfügbar machen. Das Land unterstützt Kommunen bei der Umwandlung bestehender Pläne. mehr...
ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis
[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...
Vitako: Die Verwaltung der Zukunft im Podcast
[16.01.2026] Orientierung schaffen, Debatten anstoßen und zeigen, wie öffentliche IT den digitalen Staat mitgestaltet – das will der neue Podcast von Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. mehr...
KDO: IT-Wissen praxisnah vermittelt
[14.01.2026] Die KDO-Akademie vermittelt IT-Kompetenz: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Schulungen durchgeführt. Nun entwickelt sich das Angebot weiter. In verschiedenen Formaten wird neben Know-how zu konkreten IT-Lösungen auch Wissen zu übergreifenden Themen vermittelt. mehr...
Köln: Erster IT-Planungsprozess
[22.12.2025] Um die IT- und Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung schneller bewerten und priorisieren zu können, hat Köln erstmals einen gesamtstädtischen IT-Planungsprozess umgesetzt. Er orientiert sich an Industriestandards für die IT-Planung in Unternehmen und sorgt für einen optimalen Ressourceneinsatz sowie eine nachhaltig gesteuerte digitale Transformation. mehr...
Aachen: Straßenbäume exakt dokumentiert
[19.12.2025] In Aachen wurden in den vergangenen Jahren alle Stadtbäume mit Stamm- und Zustandsdaten in ein Kataster eingepflegt. Das soll der Stadtverwaltung künftig alle Prozesse rund um Baumkontrolle und -pflege erleichtern. mehr...
Cuxhaven: Schnell informiert im Notfall
[19.12.2025] Seit 2005 informiert die Stadt Cuxhaven ihre Bürgerinnen und Bürger über regionale Gefahrenlagen oder Schadensereignisse per App. Nun erhielt die mobile Anwendung ein umfassendes Update. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Zwischen Medienbrüchen und Bürokratiearbeit
[03.12.2025] Was macht einen Verwaltungsprozess wahrhaft nutzerfreundlich? Dieser Frage geht – anhand des Wohngeldantrags – eine Studie von Fraunhofer FOKUS nach. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein handlungsleitendes Gesamtbild der Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln. mehr...
NeXT: Breite Umfrage zur Nachnutzung
[27.11.2025] Wie steht es um die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung? Das Netzwerk NeXT hat dazu eine Umfrage aufgesetzt Alle Verwaltungsbeschäftigten – ungeachtet der Ebene oder Rolle – können noch bis Ende November ihre Praxiserfahrungen teilen. mehr...
Metropolregion Rhein-Neckar: Kooperationsraum für moderne Verwaltung
[25.11.2025] Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die Metropolregion Rhein-Neckar bauen ihre seit 2010 bestehende Kooperation aus und richten einen föderalen Kooperationsraum ein, der digitale Lösungen länder- und ebenenübergreifend entwickelt und erprobt. mehr...
Studie: Intern besser integrieren
[20.11.2025] Wie erleben Behördenmitarbeitende die Digitalisierungsbemühungen in ihrem Alltag? Dies wollte das Unternehmen d.velop herausfinden. Ein Ergebnis der Umfrage: Eine vollständige Digitalisierung bis 2030 halten 75 Prozent der Befragten für unrealistisch. mehr...
Lohr a.Main: Neue Perspektiven eröffnet
[19.11.2025] Ilona Nickel aus der IT-Abteilung der Stadt Lohr a.Main zählt zu den ersten Absolventen des Weiterbildungslehrgangs Digitalwirt. Im Interview erklärt sie, was den Lehrgang besonders macht und wie ihr dieser hilft, die Digitalisierung in Lohr voranzutreiben. mehr...
Mainz: Mit Sportstättenverzeichnis online
[14.11.2025] In Mainz können jetzt die Belegungspläne von zunächst 20 Sporthallen online eingesehen werden. Weitere Hallen sollen sukzessive folgen. mehr...
Initiative Ehrenbehörde: Michelin-Stern für Behörden
[28.10.2025] Zwölf Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden jetzt für neue Standards in Kommunikation, Digitalisierung und Führung als „Ehrenbehörden 2026“ ausgezeichnet. mehr...