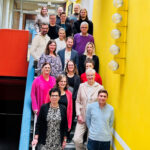Geräte-ManagementStandards für den sicheren Betrieb

MDM-Lösungen helfen bei der sicheren Verwaltung mobiler Geräte.
(Bildquelle: PEAK Agentur für Kommunikation)
Smartphones und Tablets haben in der öffentlichen Verwaltung in den vergangenen Jahren vermehrt Einzug gehalten. Die Nutzung mobiler Endgeräte umfasst auch die Speicherung und Verarbeitung sensibler Informationen. Dabei können vielfältige Bedrohungen und Risiken entstehen, denen unter anderem mit technischen Hilfsmitteln begegnet werden muss.
Mithilfe von Systemen für das Mobile Device Management (MDM) können mobile Endgeräte in die IT-Infrastruktur einer Verwaltung integriert und zentral verwaltet werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat für Stellen der Bundesverwaltung technische und organisatorische Mindeststandards definiert, die ein MDM-System zu erfüllen hat, wenn es in einer Stelle des Bundes eingesetzt werden soll – daran können sich auch die Kommunen orientieren.
Funktionale Anforderungen
Der Mindeststandard des BSI formuliert unter anderem funktionale Sicherheitsanforderungen an die Arbeitsweise der MDM-Lösung. So müssen etwa Nutzdaten des MDM innerhalb der IT-Infrastruktur des Betreibers verbleiben. Wird das MDM ganz oder teilweise von einem externen Cloud-Anbieter bezogen, sind zusätzlich die Anforderungen des BSI-Mindeststandards zur Nutzung externer Cloud-Dienste einzuhalten. Des Weiteren gilt: Werden mehrere Mandanten auf einem MDM verwaltet, so muss eine wirksame Trennung erfolgen.
Ein wichtiger Punkt zum Schutz des Mobile Device Management und der Konfiguration ist zudem, dass kompromittierte mobile Endgeräte zeitnah erkannt und vom MDM ausgeschlossen werden. Es muss also gewährleistet werden, dass Sicherheitsvorfälle dem Administrator in geeigneter Weise angezeigt werden. Des Weiteren muss das MDM über ein Rechte-Management verfügen, das sicherstellt, dass Benutzergruppen und Administratoren nur über solche Zugriffsrechte verfügen, die für die Aufgabenerfüllung notwendig sind (Minimalprinzip).
Im Rahmen der Applikationsverwaltung legt der Mindeststandard des BSI fest, dass eine zentrale Verteilung von Applikationen möglich sein muss. Werden Sicherheitsprobleme einer Applikation bekannt, so muss diese zeitnah von allen mobilen Endgeräten deinstalliert werden können. Dieser Vorgang muss durch das MDM erzwungen werden können. Im Rahmen des Mobile Device Management muss zudem der Lebenszyklus einschließlich der Konfigurationshistorie eines jeden in der Verwaltung eingesetzten mobilen Endgeräts ausreichend protokolliert und zentral abrufbar sein. Bei Bedarf muss der Administrator den aktuellen Status der verwalteten Endgeräte ermitteln können (Device Audit). Das umfasst insbesondere die Abfrage sicherheitstechnisch relevanter Konfigurationseinstellungen, installierter Zertifikate und Applikationen.
Sicher konfigurieren und betreiben
Hinsichtlich der sicheren Konfiguration mobiler Endgeräte in der öffentlichen Verwaltung hat das BSI unter anderem Vorgaben für die Konfigurationsprofile, die sichere Erstinstallation, zu Kennwörtern und Gerätecodes, Zertifikaten sowie zur Verschlüsselung des Gerätespeichers erarbeitet.
Wichtige Punkte sind zudem die Fernlöschung (Remote Wipe) und Außerbetriebnahme sowie die automatische Sperre von Geräten (Remote Lock). So muss das MDM laut BSI sicherstellen, dass sämtliche Daten auf dem mobilen Endgerät, einschließlich Zugangsdaten und Zertifikaten, auch aus der Ferne gelöscht werden können. Werden in dem mobilen Endgerät externe Speicher genutzt, ist zu prüfen, ob diese bei einem Remote Wipe ebenfalls gelöscht werden sollen und ob dies vom MDM unterstützt wird. Der Prozess zur Außerbetriebnahme des mobilen Endgeräts (Unenrollment) muss gewährleisten, dass darauf sowie auf den eingebundenen Speichermedien keine sensitiven Daten verbleiben – insbesondere dann, wenn das Unenrollment aus der Ferne durchgeführt wird. Die Einrichtung und wirksame Durchsetzung einer automatischen Sperre des mobilen Endgeräts nach Zeitvorgabe muss zentral konfigurierbar sein. Eine Gerätesperrung muss durch den Administrator auch aus der Ferne möglich sein (Remote Lock). Kann der Remote Lock auf dem mobilen Endgerät nicht ausgeführt werden, muss dies vom MDM angezeigt werden können.
Die Wirksamkeit von Sicherheitsmechanismen hängt auch vom jeweiligen Betrieb ab. Der Betreiber der mobilen Endgeräte hat daher nach Angaben des BSI einige technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen. So müssen etwa wirksame Mechanismen für das Backup aller Daten und Einstellungen des MDM existieren, sodass dieses im Bedarfsfall funktionsfähig wiederhergestellt werden kann. Fernzugriffe auf das MDM müssen auf einem kryptografisch abgesicherten Kanal erfolgen (vertraulich, integer, authentisch). Alle in einer Behörde eingesetzten mobilen Endgeräte sind in dem MDM zu verwalten und müssen sich vor Verteilung der Grundkonfiguration im Werkszustand befinden. Organisatorisch empfiehlt das BSI, geschulte Administratoren zur Bedienung eines Mobile Device Management einzusetzen und die Nutzer mobiler Endgeräte für Sinn und Zweck der festgelegten Sicherheitsmaßnahmen zu sensibilisieren. Wichtig auch: Konfigurationsprofile und Sicherheitseinstellungen sind regelmäßig zu überprüfen.
Auf Sicherheitsvorfälle vorbereitet sein
Aber selbst wenn alle notwendigen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, lassen sich Sicherheitsvorfälle nicht immer verhindern. Für diesen Fall muss ein angemessener Prozess etabliert sein, der insbesondere folgende Szenarien abdeckt: Verlust eines mobilen Endgeräts, Verlust der Integrität des mobilen Endgeräts (etwa durch Jailbreak oder Rooting), kein Kontakt des mobilen Endgeräts zum MDM über einen längeren Zeitraum hinweg. Zudem müssen Arbeitsprozesse geplant, getestet und angemessen dokumentiert sein, um sicherheitsrelevante Patches und Updates unverzüglich einspielen zu können. MDM-Systeme und mobile Endgeräte, für die keine sicherheitsrelevanten Aktualisierungen mehr bereitgestellt werden, sind außer Betrieb zu nehmen.
Außerdem ist sicherzustellen, dass ausschließlich sicherheitsgeprüfte Applikationen bereitgestellt werden. Dabei helfen kann ein definierter Freigabeprozess mit geeigneten Bewertungskriterien. Die Nutzung von vorinstallierten Applikationen und Online-Diensten, insbesondere von externen cloudbasierten Diensten, muss bewertet und im Bedarfsfall systemseitig verhindert werden. Die Freischaltung von Schnittstellen und Funktionen ist zu regeln und auf das dienstlich notwendige Maß zu reduzieren.
Auch die Peripherie berücksichtigen
Die Einführung mobiler Endgeräte bringt für die Verantwortlichen zudem die Pflicht mit sich, datenschutzrechtliche, sicherheitstechnische und betriebliche Anforderungen für die Einbindung von Peripherie-Geräten zu definieren. So ist es oft alles andere als einfach, eine Strategie zum mobilen Drucken zu implementieren, da innerhalb der meisten Institutionen eine breite Palette von Hardware, Software und Serviceangeboten je nach Drucker und zugrunde liegender Druckerinfrastruktur berücksichtigt werden muss. Die Evaluierung, welche Lösung die Sicherheitsstrategie der Institution hierbei am besten unterstützt, sollte ein fester Bestandteil der Planungs- und Konzeptionsphase sein. Ansonsten ist damit zu rechnen, dass die Nutzer mobiler Endgeräte sich Workarounds aufbauen, um die etablierten Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.
Da es eine Vielzahl von MDM-Produkten auf dem Markt gibt, empfiehlt das BSI, bei der Auswahl vor allem darauf zu achten, dass die Lösung die definierten Anforderungen einer Behörde unterstützt. Die Verantwortlichen sollten sicherstellen, dass nur solche MDM-Software genutzt oder beschafft wird, die alle technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen umsetzen kann und alle freigegebenen mobilen Endgeräte unterstützt.
Dieser Beitrag ist in der Dezember-Ausgabe von Kommune21 im Schwerpunkt Geräte-Management erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Urbane Datenplattformen: Wichtiger Schlüssel
[15.07.2025] Urbane Datenplattformen sind der Schlüssel zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung. Die Einführung und Nutzung bringen für Kommunen neben vielen Mehrwerten jedoch auch Herausforderungen mit sich. mehr...
Kreis Traunstein: Weblösung reduziert Arbeitslast
[08.07.2025] Eine speziell auf die Verwaltung von Asylbewerbern, Unternehmen und gemeinnützigen Trägern ausgerichtete Weblösung unterstützt Kommunen bei der Koordination gemeinnütziger Aufgaben. Sie setzt auf Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI) und wurde gemeinsam mit dem Kreis Traunstein entwickelt. mehr...
Cadolzburg: Signieren ohne Tinte
[03.07.2025] Seit über einem Jahr nutzt die Marktgemeinde Cadolzburg den Signaturservice der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). Um Zertifikate selbstständig ausstellen und administrieren zu können, führte sie 2025 ergänzend das Zertifikatsportal des IT-Dienstleisters ein. mehr...
Digitale Souveränität: Ist die Schmerzgrenze erreicht?
[02.07.2025] Auf dem Zukunftskongress Staat & Verwaltung diskutierten Experten in der vergangenen Woche den aktuellen Stand bei der digitalen Souveränität. Diese ist durch geopolitische Verschiebungen wieder ins Blickfeld der Politik geraten. Ob die Marktdominanz von US-Konzernen bei Netzen und Software in der öffentlichen Verwaltung überwunden werden kann, erscheint indes weiter ungewiss. mehr...
KGSt: Kritik an Deutscher Verwaltungscloud
[01.07.2025] Die KGSt unterstützt die Deutsche Verwaltungscloud grundsätzlich – sieht aber Nachbesserungsbedarf bei Steuerung, Wirtschaftlichkeit und technischer Umsetzung. mehr...
Nordrhein-Westfalen: Digital-Index für das Ruhrgebiet
[01.07.2025] Erstmals wurde für die 53 Kommunen im Ruhrgebiet ein Digital-Index erstellt. Er nimmt verschiedene Themenfelder in den Blick, darunter die Bereiche Forschung, Beschäftigung, Unternehmen und Infrastruktur. Auch wurde das Gebiet mit elf anderen Metropolregionen in Deutschland verglichen. mehr...
Nürnberg: AutiSta aus der AKDB Cloud
[23.06.2025] Auf AutiSta als Software-as-a-Service bei der AKDB setzt die Stadt Nürnberg. Im Rahmen des Projekts hat die Frankenmetropole eng mit dem Fachverfahrenshersteller und dem IT-Dienstleister zusammengearbeitet. mehr...
GIS Consult / RIB IMS: CAFM-System mit GIS-Anbindung
[19.06.2025] Die Unternehmen RIB IMS und GIS Consult haben die bidirektionale Systemintegration der CAFM-Software RIB FM und des Geo-Informationssystems Smallworld GIS ausgeweitet. Flurstücke lassen sich somit grafisch visualisieren und darüber Prozesse für Verwaltungsaufgaben aller Art managen. mehr...
E-Rechnungspflicht: So gelingt die Umstellung
[17.06.2025] Mit der Einführung der E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich erwartet Kommunen ein deutlicher Anstieg eingehender E-Rechnungen. Angesichts dessen hat der Softwarehersteller xSuite sein Angebot in diesem Bereich ausgebaut und setzt dabei auch auf eine Cloudplattform. mehr...
Föhr-Amrum: Mit vereinten Kräften
[28.05.2025] Das Amt Föhr-Amrum hat vor rund einem Jahr eine Verwaltungskooperation mit dem Land Schleswig-Holstein getroffen. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. mehr...
IT.NRW: Basis der Modernisierung
[26.05.2025] Mit einer föderal anschlussfähigen Multi-Cloud-Architektur unterstützt IT.NRW den Aufbau interoperabler IT-Strukturen, entwickelt standardisierte Verwaltungsdienste und trägt zur sicheren Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus bei. mehr...
Freudenberg: Bürgerbüro arbeitet effizienter
[26.05.2025] Ein neues Terminvereinbarungs- und Besucherleitsystem optimiert in der Stadt Freudenberg die Arbeitsabläufe im Bürgerbüro. Das kommt nicht nur den Verwaltungsmitarbeitenden, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern zugute. mehr...
Hüttener Berge: Digitale Überzeugungstäter
[15.05.2025] Als eine der ersten Kommunen in Schleswig-Holstein hatte das Amt Hüttener Berge eine Digitalisierungsstrategie und hat inzwischen zahlreiche Maßnahmen seiner Digitalen Agenda umgesetzt. Die gewonnenen Erkenntnisse kommen auch anderen Kommunen zugute. mehr...
Ennepe-Ruhr-Kreis: Interkommunales Prozessmanagement
[14.05.2025] In einem interkommunalen Projekt widmen sich der Ennepe-Ruhr-Kreis und die Städte Witten, Hattingen, Gevelsberg, Wetter und Sprockhövel dem Prozessmanagement. Unter anderem wollen sie ein gemeinsames Prozessregister aufbauen. Der Austausch zwischen den Teilnehmenden ist ein zentraler Aspekt des Vorhabens. mehr...
Stuttgart: Plattform erleichtert Zusammenarbeit
[12.05.2025] Einfach, effizient und dennoch sicher soll die digitale Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung Stuttgart vonstatten gehen. Gleiches gilt für den Datenaustausch mit externen Partnern. Dafür setzt die baden-württembergische Landeshauptstadt nun eine Kollaborationsplattform ein. mehr...