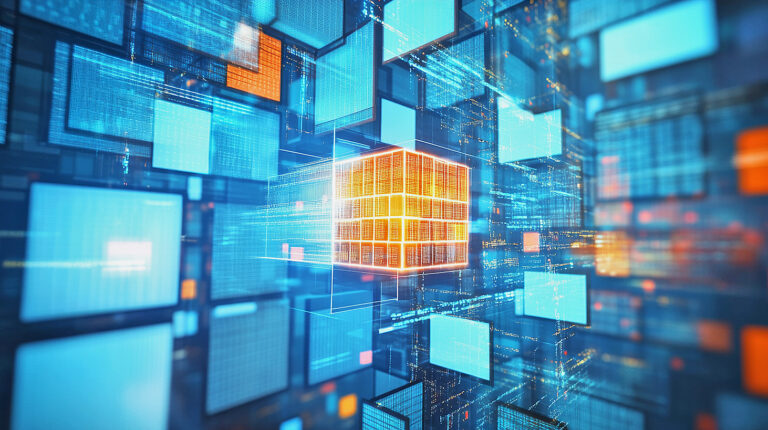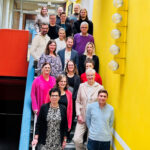Urbane DatenplattformenWichtiger Schlüssel

Urbane Datenplattformen fungieren als zentrale Datendrehscheibe.
(Bildquelle: Panuwat/stock.adobe.com)
Kommunen weltweit begegnen täglich vielen verschiedenen Herausforderungen, beispielsweise in den Bereichen Verkehrsüberlastung, Luftverschmutzung, Klimaanpassung oder sozialer Ungleichheit. Digitale Technologien ermöglichen durch vorausschauende Steuerung oder Planung kommunaler Prozesse die Lösung dieser Probleme und befähigen zur Schaffung völlig neuer Dienstleistungen – sie benötigen jedoch eine fundierte Datenbasis, für deren Bereitstellung sich urbane Datenplattformen (UDP) anbieten. Diese fungieren als Datendrehscheibe – sie integrieren unterschiedlichste Daten verschiedener Quellen und stellen diese anderen Systemen zentral zur Verfügung.
In Verbindung mit Smart Services oder Digitalen Zwillingen können die Daten für Simulationen und neue Lösungen genutzt werden und ermöglichen fundierte, nachvollziehbare Entscheidungen. Damit unterstützen urbane Datenplattformen die nachhaltige Entwicklung von Kommunen. Städte können durch deren Nutzung effizienter agieren und Bürgerinnen und Bürger aktiv in den Gestaltungsprozess einbeziehen, um auf diesem Wege eine lebenswertere Umgebung zu schaffen.
Technologisch unterscheiden sich UDP nach ihren Spezialisierungen, etwa auf Themen wie Open Data, Internet of Things, Big Data oder Geodaten. Generell müssen urbane Datenplattformen aber verschiedene Arten kommunaler Daten verarbeiten können. Hochspezialisierte Datenplattformen, etwa für Geodaten allein, kann man nicht als echte UDP bezeichnen.
Konkrete Ziele setzen
Die Einführung einer UDP birgt für Kommunen viele Chancen und Mehrwerte. So ermöglicht die zentrale Datenbereitstellung mittels UDP datenbasierte Analysen sowie das Verschneiden von Daten verschiedener Domänen, um fundierte Entscheidungen und neue Einsichten zu unterstützen, beispielsweise in der Stadtplanung und -entwicklung. Darüber hinaus lässt sich mit einer UDP Interoperabilität herstellen, sie kann die Effizienz kommunaler Arbeit und der Bürgerbeteiligung steigern, dient der Innovationsförderung und verbessert Nachhaltigkeit sowie Lebensqualität.
Dem stehen jedoch auch einige Herausforderungen gegenüber. Dazu gehört unter anderem, Datenschutz und Datensicherheit sicherzustellen und die Datenqualität zu gewährleisten. Zudem gilt es, Daten verschiedener Systeme zu integrieren, die komplexe Entwicklung und Wartung der technischen Infrastrukturen zu bewältigen sowie finanzielle und personelle Ressourcen für die Wartung und den Betrieb der UDP sicherzustellen. Zu guter Letzt muss bei Bürgerinnen und Bürgern Akzeptanz für die Plattform geschaffen werden.
Wichtig bei der Auswahl und Einführung einer urbanen Datenplattform ist die Zieldefinition der Kommune: Was soll durch die Einführung erreicht werden? Für die Datenplattform sollten konkrete Ziele gesetzt werden, sodass sie allen Akteuren einen Nutzen bringt und auch die notwendigen Zuarbeiten klar werden. Dieses Vorgehen hilft, ein gemeinsames Verständnis für einheitliche Datenstandards und -qualität zu etablieren, um eine möglichst hohe Nutzbarkeit von Daten zu ermöglichen.
Anforderungen zusammentragen
Seit Veröffentlichung der Publikation „Urbane Datenplattformen“ im Jahr 2023 hat sich einiges getan. So wird derzeit die im Jahr 2017 veröffentlichte DIN SPEC 91357, die den weiten Kontext über kommunale digitale Ökosysteme spannt, mit der DIN SPEC 91377 konkretisiert. Diese DIN SPEC mit dem Titel „Datenmodelle und Protokolle in offenen urbanen Plattformen“ benennt nicht nur relevante Datenformate und Protokolle, die durch UDP unterstützt werden sollten. Sie schärft auch den Blick für Aufgaben, Funktionen und Architektur von UDP im kommunalen Ökosystem.
Die Sicherheit urbaner Datenplattformen hat in den vergangenen Monaten zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Sie ist besonders relevant, da diese Plattformen häufig sensible Daten speichern, beispielsweise Informationen zu den sozialen Strukturen in verschiedenen Bereichen einer Stadt oder zu kommunalen Infrastrukturen. Die Sicherheit von Datenplattformen ist vor allem wichtig, wenn sie zu sicherheitskritischen Zwecken eingesetzt werden. Dann stehen neben der Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten vor allem die Integrität sowie die Verfügbarkeit im Fokus.
Um die Sicherheit urbaner Datenplattformen zu stärken, hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Ende Februar 2025 die technische Richtlinie TR-03187 veröffentlicht. Diese definiert spezifische Sicherheitsanforderungen an UDP und deren Betrieb, wodurch typische Schwächen beim Einsatz dieser Plattformen vermieden werden sollen.
Zur Einführung einer urbanen Datenplattform sollten zunächst im Rahmen einer Konzeptionsphase die Ziele und Anwendungsfälle der Kommune identifiziert werden, um daraus Anforderungen ableiten zu können. Die Konkretisierung möglicher Anwendungsfälle dient auch dazu, die Datenplattform greifbar zu machen und den Nutzen einer solchen Investition zu zeigen. Da sich eine UDP in die kommunale IT-Infrastruktur einfügen muss, ist eine frühzeitige Einbindung der IT-Abteilung und die Dokumentation existierender Systeme und Schnittstellen unabdingbar. Sind alle Anforderungen an die Lösung gesammelt, stellen sich für Kommunen weitere Fragen für die Planung oder Ausschreibung. Diese umfassen Entwicklungs- und Betreibermodell sowie die Wahl des Lizenzmodells.
Entwicklungs-, Betreiber- und Lizenzmodelle
Beim Entwicklungsmodell kommen im Wesentlichen Eigenentwicklung, Entwicklungspartnerschaft oder Fremdbezug einer etablierten Lösung infrage. Während die Eigenentwicklung eine maßgeschneiderte Lösung liefert, jedoch ressourcenintensiv ist, können bei Entwicklungspartnerschaften Synergien entstehen und Entwicklungskosten geteilt werden – zu Lasten einer intensiveren Koordination. Bei einem Fremdbezug kann unmittelbar auf hohe externe Kompetenz zugegriffen werden, jedoch ist die Gefahr von Abhängigkeiten zu einem Anbieter gegeben.
Mögliche Betreibermodelle sind der Eigenbetrieb, der Betrieb im kommunalen Rechenzentrum oder der Betrieb durch spezialisierte externe Anbieter. Während mit dem Eigenbetrieb das höchste Maß an Datensouveränität einhergeht, entstehen auch hohe Ressourcenaufwände. Bei der Wahl eines externen Dienstleisters mit entsprechenden Kompetenzen reduziert sich dieser Aufwand zu Lasten der eigenen digitalen Souveränität. Hinsichtlich des Lizenzmodells bieten Open-Source-Lösungen eine höhere Akzeptanz in Projekten mit öffentlicher Förderung und lassen mehr Zukunftssicherheit bei geringerer Anbieterabhängigkeit erwarten. Zudem erleichtert Open-Source-Software die Nachnutzung entwickelter Lösungen durch andere Kommunen.
Kreis Traunstein: Weblösung reduziert Arbeitslast
[08.07.2025] Eine speziell auf die Verwaltung von Asylbewerbern, Unternehmen und gemeinnützigen Trägern ausgerichtete Weblösung unterstützt Kommunen bei der Koordination gemeinnütziger Aufgaben. Sie setzt auf Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI) und wurde gemeinsam mit dem Kreis Traunstein entwickelt. mehr...
Cadolzburg: Signieren ohne Tinte
[03.07.2025] Seit über einem Jahr nutzt die Marktgemeinde Cadolzburg den Signaturservice der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). Um Zertifikate selbstständig ausstellen und administrieren zu können, führte sie 2025 ergänzend das Zertifikatsportal des IT-Dienstleisters ein. mehr...
Digitale Souveränität: Ist die Schmerzgrenze erreicht?
[02.07.2025] Auf dem Zukunftskongress Staat & Verwaltung diskutierten Experten in der vergangenen Woche den aktuellen Stand bei der digitalen Souveränität. Diese ist durch geopolitische Verschiebungen wieder ins Blickfeld der Politik geraten. Ob die Marktdominanz von US-Konzernen bei Netzen und Software in der öffentlichen Verwaltung überwunden werden kann, erscheint indes weiter ungewiss. mehr...
KGSt: Kritik an Deutscher Verwaltungscloud
[01.07.2025] Die KGSt unterstützt die Deutsche Verwaltungscloud grundsätzlich – sieht aber Nachbesserungsbedarf bei Steuerung, Wirtschaftlichkeit und technischer Umsetzung. mehr...
Nordrhein-Westfalen: Digital-Index für das Ruhrgebiet
[01.07.2025] Erstmals wurde für die 53 Kommunen im Ruhrgebiet ein Digital-Index erstellt. Er nimmt verschiedene Themenfelder in den Blick, darunter die Bereiche Forschung, Beschäftigung, Unternehmen und Infrastruktur. Auch wurde das Gebiet mit elf anderen Metropolregionen in Deutschland verglichen. mehr...
Nürnberg: AutiSta aus der AKDB Cloud
[23.06.2025] Auf AutiSta als Software-as-a-Service bei der AKDB setzt die Stadt Nürnberg. Im Rahmen des Projekts hat die Frankenmetropole eng mit dem Fachverfahrenshersteller und dem IT-Dienstleister zusammengearbeitet. mehr...
GIS Consult / RIB IMS: CAFM-System mit GIS-Anbindung
[19.06.2025] Die Unternehmen RIB IMS und GIS Consult haben die bidirektionale Systemintegration der CAFM-Software RIB FM und des Geo-Informationssystems Smallworld GIS ausgeweitet. Flurstücke lassen sich somit grafisch visualisieren und darüber Prozesse für Verwaltungsaufgaben aller Art managen. mehr...
E-Rechnungspflicht: So gelingt die Umstellung
[17.06.2025] Mit der Einführung der E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich erwartet Kommunen ein deutlicher Anstieg eingehender E-Rechnungen. Angesichts dessen hat der Softwarehersteller xSuite sein Angebot in diesem Bereich ausgebaut und setzt dabei auch auf eine Cloudplattform. mehr...
Föhr-Amrum: Mit vereinten Kräften
[28.05.2025] Das Amt Föhr-Amrum hat vor rund einem Jahr eine Verwaltungskooperation mit dem Land Schleswig-Holstein getroffen. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. mehr...
IT.NRW: Basis der Modernisierung
[26.05.2025] Mit einer föderal anschlussfähigen Multi-Cloud-Architektur unterstützt IT.NRW den Aufbau interoperabler IT-Strukturen, entwickelt standardisierte Verwaltungsdienste und trägt zur sicheren Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus bei. mehr...
Freudenberg: Bürgerbüro arbeitet effizienter
[26.05.2025] Ein neues Terminvereinbarungs- und Besucherleitsystem optimiert in der Stadt Freudenberg die Arbeitsabläufe im Bürgerbüro. Das kommt nicht nur den Verwaltungsmitarbeitenden, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern zugute. mehr...
Hüttener Berge: Digitale Überzeugungstäter
[15.05.2025] Als eine der ersten Kommunen in Schleswig-Holstein hatte das Amt Hüttener Berge eine Digitalisierungsstrategie und hat inzwischen zahlreiche Maßnahmen seiner Digitalen Agenda umgesetzt. Die gewonnenen Erkenntnisse kommen auch anderen Kommunen zugute. mehr...
Ennepe-Ruhr-Kreis: Interkommunales Prozessmanagement
[14.05.2025] In einem interkommunalen Projekt widmen sich der Ennepe-Ruhr-Kreis und die Städte Witten, Hattingen, Gevelsberg, Wetter und Sprockhövel dem Prozessmanagement. Unter anderem wollen sie ein gemeinsames Prozessregister aufbauen. Der Austausch zwischen den Teilnehmenden ist ein zentraler Aspekt des Vorhabens. mehr...
Stuttgart: Plattform erleichtert Zusammenarbeit
[12.05.2025] Einfach, effizient und dennoch sicher soll die digitale Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung Stuttgart vonstatten gehen. Gleiches gilt für den Datenaustausch mit externen Partnern. Dafür setzt die baden-württembergische Landeshauptstadt nun eine Kollaborationsplattform ein. mehr...