RegistermodernisierungSteuer-ID ins Register
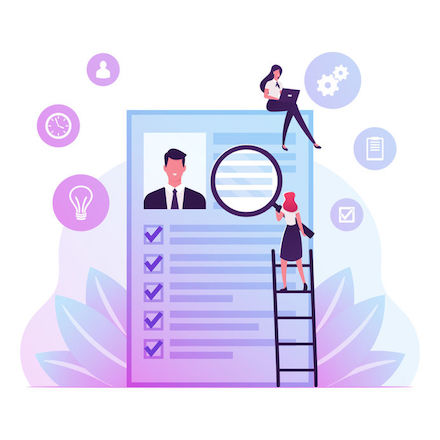
Die Steuer-ID in die Register zu heben, wird mitunter zum Kraftakt.
(Bildquelle: Pavlo Syvak / 123rf.com)
Kaum ein Gesetz, das im Laufe der vergangenen zwölf Monate Bundestag und Bundesrat passierte, hat so viele Diskussionen hervorgerufen wie das Registermodernisierungsgesetz (ReMoG). Das betrifft sowohl die Öffentlichkeit als auch das parlamentarische Vorspiel zu diesem Gesetz. Im Kern der Diskussion stand dabei die Vereinbarkeit des Gesetzes mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus den frühen 1980er-Jahren. Nahezu 40 Jahre später ist klar, dass sich die Welt stark verändert hat und es sicher angesagt ist, die neue Welt und die Grundgedanken des damaligen Urteils in Einklang zu bringen. Das ist aber die Aufgabe der Juristen. Von nicht minderer Bedeutung ist, wie die mit dem Gesetz angepeilten Ziele praktisch, vor allem technisch, umgesetzt werden können. Mit dem RegMoG soll es möglich werden, Verwaltungsdaten sicher und datenschutzkonform der richtigen Person zuzuordnen. Als veränderungsfestes Ordnungsmerkmal dient die Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID). Der Grundgedanke des Gesetzes ist es, ein verwaltungsinternes, registerübergreifendes Identitätsmanagement mit maximaler Transparenz (Datencockpit) zu schaffen.
Gemeinsamer Hintergrund
Verschiedentlich wird die Registermodernisierung als Folge oder als Parallelprozess des Onlinezugangsgesetzes (OZG) gesehen. Das ist zu kurz gegriffen. Der gemeinsame Hintergrund, sowohl für die Registermodernisierung als auch für das OZG, muss eine moderne Verwaltung mit effektiven Strukturen und effizienten Abläufen sein. Die dafür notwendige Verwaltungsmodernisierung ist leider nicht mit dem gleichen Engagement vorangetrieben worden, wie das OZG. Deshalb ist es auch nicht zielführend, die Registermodernisierung nur als Unterstützung für das OZG zu sehen. Vielmehr ist sie eine elementare Voraussetzung für die gesamte zukünftige Verwaltung, die Online-Lösung eingeschlossen.
Wenn in diesem Zusammenhang von einem registerübergreifenden Identitätsmanagement gesprochen wird, muss klar sein, dass dieses Identitätsmanagement und die notwendige digitale Identität des Bürgers zwei grundlegend verschiedene Dinge sind. Das Identitätsmanagement verbindet die einzelnen Verwaltungssegmente miteinander, die digitale Identität verbindet den Online-Bürger mit der Verwaltung. Für eine einfache und geradlinige Umsetzung des Once-Only-Prinzips sind beide Themen zwingend erforderlich. Die digitale Identität, um dem Bürger quasi Einlass in die Verwaltung zu gewähren und das Identitätsmanagement, um den durch den Bürger ausgelösten Vorgang umfassend und verwaltungsübergreifend bearbeiten zu können.
Einen Schritt weiter gehen
Für den Bürger sieht das Gesetz das Datencockpit vor, denn es soll für ihn verifizierbar sein, in welchen Fällen mit der Identifikationsnummer Daten übermittelt wurden. Vielleicht müsste man im Interesse des Bürgers sogar noch einen Schritt weitergehen. Zukünftig sollte automatisch jede Nutzung der Steuer-ID protokolliert werden. Dies muss nicht Bestandteil des Datencockpits sein, eine solche Protokollierung wäre ausreichend für verwaltungsinterne Prüfzwecke.
Doch bevor über irgendeine Nutzung der Steuer-ID nachgedacht werden kann, muss die Nummer in alle Register aufgenommen werden. Dieser Schritt ist viel aufwendiger als derzeit prognostiziert. So hat etwa das Personenstandsregister nicht zur Aufgabe, aktuelle Daten zu führen. Ein Abgleich der Basisdaten wird somit nur schwer oder mit hohem Aufwand möglich sein. Es gibt auch Register, die nicht zwingend (rechtlich definiert) eine permanente Aktualisierung der gespeicherten Registerdaten vornehmen. Dies dürfte im Adressbereich und im Bereich der Namensänderung zu unmittelbaren Problemen führen.
Nicht genau genug
All diese Schwierigkeiten sind sofort behoben, wenn die Identifikationsnummer in den Registern eingetragen ist. Dann können die Basisdaten über die Steuer-ID und das Geburtsdatum der Person bei der Registermodernisierungsbehörde gemäß RegMoG §6, Absatz 3.2 abgerufen werden. Aber Voraussetzung ist eben, dass die Identifikationsnummer in den verschiedenen Registern enthalten ist. Dazu soll die Abfrage nach §6, Absatz 3.1 genutzt werden, wonach Familienname, Wohnort, Postleitzahl und Geburtsdatum für eine Abfrage erforderlich sind. Alle Erfahrungen zeigen jedoch, dass diese Abfrage nicht genau genug ist.
Somit lautet die zentrale Frage, wie die Identifikationsnummer in die einzelnen Register gelangt. Dazu ist zunächst deren jeweilige Datenqualität zu prüfen. Sind die notwendigen Daten für eine Abfrage bei der Registermodernisierungsbehörde oder bei der Meldebehörde überhaupt vorhanden? Was passiert, wenn dem nicht der Fall ist? Sind die Daten innerhalb des Registers in sich schlüssig?
Tiefenprüfung erforderlich
Im VOIS-Projekt des Software-Unternehmens HSH wurden solche Verfahrensweisen bereits vorgedacht. Denn die Erfahrung zeigt, dass es durch Schreibfehler in der Vergangenheit, durch nicht aktualisierte Daten oder andere Missverständnisse (etwa Parallel- oder Mehrfacherfassung) immer wieder erforderlich ist, eine Tiefenprüfung von Einzelfällen vorzunehmen. Aufgrund dieser Erfahrungen ist klar, dass ein rein automatisierter Prozess zur Eintragung der Identifikationsnummer nicht möglich ist. In jeder registerführenden Stelle wird es zu einem manuellen Aufwand kommen, der nur schwer einzuschätzen ist, jedoch in jedem Fall höher liegt als vom Gesetz erwartet.
Komplexe Abfrage
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Registermodernisierung ist das bereits erwähnte Datencockpit. Die dafür notwendigen Protokolle müssen an den einzelnen Registern erstellt werden. Dies macht eine Abfrage durch das Cockpit sehr komplex. Es ist gegebenenfalls zu prüfen, ob nicht ein Protokollregister auf jeder Verwaltungsebene zweckmäßig sein könnte, sodass es in einer Kommunalverwaltung nur eine relevante Datenquelle für Abfragen gibt. Das sollte die Geschwindigkeit und die Komplexität einer Cockpitabfrage wesentlich verbessern.
Es ist unstrittig, dass in einer modernen Verwaltung die Ämter und Behörden untereinander vernetzt sein müssen. Das erwartet der Bürger als Kunde der Verwaltung und als Steuerzahler – eine effiziente, an den Bedürfnissen des Bürgers orientierte Verwaltung. Nicht zuletzt verlangen dies auch die Mitarbeiter der Verwaltung, denn auch sie wollen moderne Arbeitsmittel und -prozesse für ihre Tätigkeit nutzen. Es gilt: Alles in allem ist das Registermodernisierungsgesetz ein wichtiger praktischer Schritt hin zu einer modernen Verwaltung.
https://www.hsh-berlin.com
Hessen: Land und Kommunen gestalten Zukunft
[23.02.2026] In Hessen haben das Land und die Kommunalen Spitzenverbände den Zukunftspakt vereinbart, um die kommunale Selbstverwaltung zu stärken. Dies soll durch den Abbau bürokratischer Lasten, eine faire Finanzierung und engere Zusammenarbeit der Ebenen bei der Digitalisierung erreicht werden. mehr...
Thüringen: Digitalisierung auf Kurs
[17.02.2026] Platz vier im Bundesvergleich, Vorreiter bei digitaler Souveränität und Open Source sowie klare Pläne für 2026 – was hinter den Zahlen steckt und wo Thüringen bewusst andere Wege geht, erläutert Landes-CIO Milen Starke im Interview. mehr...
Frankfurt am Main: Neues Transformation Office
[16.02.2026] In Frankfurt am Main übernimmt nun das Transformation Office die Steuerung der Digitalisierungsvorhaben in der Verwaltung. Wurden die Projekte bislang überwiegend dezentral realisiert, sollen diese fortan beim Transformation Office gebündelt und so effizienter und wirkungsvoller umgesetzt werden. Das Office arbeitet mit allen Ämtern der Stadt zusammen. mehr...
Heidelberg / Hochschule Ludwigsburg: Theorie und Praxis verzahnen
[09.02.2026] Mit dem Ziel, die digitale Modernisierung der Verwaltung voranzutreiben, haben die Stadt Heidelberg und die Hochschule Ludwigsburg jetzt eine Kooperation vereinbart. Geplant sind regelmäßige gemeinsame Forschungsprojekte, aus denen sich Best-Practice-Beispiele auch für andere Kommunen ableiten lassen. mehr...
Schleswig-Holstein: Konsequent digital
[28.01.2026] Von Anlagengenehmigung bis zum Wohngeld: Schleswig-Holstein setzt den Roll-out von Onlinediensten und die Digitalisierung der Verwaltung weiter konsequent um. Ein landeseigenes Digitalisierungs-Dashboard soll die Fortschritte künftig visualisieren. mehr...
OZG-Leistungen: Schub für die digitale Verwaltung
[26.01.2026] Der Bund sowie Bayern und Hessen als Pilotländer erproben einen neuen Weg, um digitale Verwaltungsdienste überall anbieten zu können. Dabei finanziert der Bund Roll-in-Teams für die Kommunen, während sich die Länder verpflichten, bis Ende 2026 fünf Online-Dienste landesweit einzuführen. Das Verfahren soll auf andere Länder übertragen werden. mehr...
Deutscher Städtetag: Lüneburgs OB ist neue Vizepräsidentin
[26.01.2026] Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch ist die neue Vizepräsidentin des Deutschen Städtetages. Sie folgt auf Katja Dörner, die im Herbst 2025 nicht erneut zur Oberbürgermeisterin gewählt wurde und somit auch aus dem Präsidium des DST ausgeschieden ist. mehr...
Potsdam: Neuer Digitalisierungsrat
[19.01.2026] In Potsdam hat sich der zweite Digitalisierungsrat der Stadt konstituiert. Er soll in den kommenden drei Jahren den digitalen Wandel der brandenburgischen Landeshauptstadt begleiten und bringt dafür Expertise aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein. mehr...
Saarland: Dritte Auflage des E-Government-Pakts
[08.01.2026] Das Saarland und die Kommunen haben die dritte Auflage ihres E-Government-Pakts unterzeichnet. Das Land wird demnach die Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und beim Ausbau digitaler Angebote unterstützen. Ein gemeinsames IT-Steuerungsgremium wird die vereinbarten Maßnahmen begleiten. mehr...
GovTech Kommunal: Kommunen digital handlungsfähig machen
[18.12.2025] Die Initiative GovTech Deutschland hat ihr Angebot um den Verein GovTech Kommunal erweitert. Es soll damit eine bundesweite Einheit geschaffen werden, welche die kommunale Digitalisierung systematisch bündelt und konsequent an den Bedarfen der Städte, Gemeinden und Landkreise ausrichtet. Die Mitgliedschaft steht mit gestaffeltem Beitragsmodell allen Kommunen offen. mehr...
Hanau: Stadtweite IT neu ausgerichtet
[18.12.2025] Hanau hat sich das Ziel gesteckt, bis 2030 die Digitalisierung der gesamten „Unternehmung Stadt“ abzuschließen. Dazu werden Entscheidungs-, Verantwortungs- und Budgetstrukturen künftig an einer Stelle gebündelt, zudem soll die Stelle des CDO geschaffen werden. mehr...
Deutscher Landkreistag: Kommunen in Modernisierungsagenda einbinden
[11.12.2025] Die von Bund und Ländern vereinbarte föderale Modernisierungsagenda bewertet der Deutsche Landkreistag (DLT) als positiv. Damit Bürger, Unternehmen und Kommunen jedoch tatsächlich entlastet werden, ist ein enger Schulterschluss mit Landkreisen, Städten und Gemeinden bei der Umsetzung erforderlich. mehr...
Sachsen-Anhalt: Zentrale Serviceagentur für Kommunen
[08.12.2025] Eine Machbarkeitsstudie aus Sachsen-Anhalt zeigt, dass eine zentrale Serviceagentur für Kommunen Verwaltungsabläufe beschleunigen und verbessern kann. Digitalministerin Lydia Hüskens kündigte an, dass ab 2026 sukzessive eine Unterstützungseinheit für Kommunen umgesetzt werden soll. mehr...
IT-Planungsrat: Kommunalbeirat NOOTS
[08.12.2025] Das Kommunalgremium des IT-Planungsrats übernimmt im Zuge der Neuaufstellung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) zusätzlich die Rolle des Kommunalbeirats NOOTS. Es hat dabei keine Entscheidungsbefugnis, sondern erfüllt eine Resonanz- und Feedbackfunktion. mehr...
4. Digitalministerkonferenz: Bessere Zusammenarbeit aller Ebenen
[27.11.2025] Bei der 4. Digitalministerkonferenz in Berlin setzte Niedersachsens Digitalministerin Daniela Behrens den Schwerpunkt auf föderale Zusammenarbeit: Sie forderte eine engere, effektivere Zusammenarbeit aller föderaler Ebenen und den Zugang zu Services des ITZBund auch für Länder und Kommunen. mehr...























