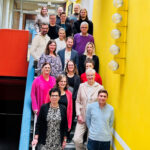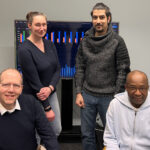BonnMobilität im Blick

Dashboard hilft beim Management lokaler Sharing-Angebote.
(Bildquelle: fottoo/stock.adobe.com)
Kommunen haben die Aufgabe, Mobilität verlässlich, nachhaltig und bedarfsorientiert zu gestalten und verschiedene Dienste bestmöglich zu vernetzen. In der Bundesstadt Bonn wird Shared Mobility als wichtiger Baustein der Mobilitätswende gesehen und soll zum Erreichen des Ziels beitragen, bis 2035 als Stadt klimaneutral zu werden. Rasant wachsende Angebote sowie fehlende Daten und Entscheidungswerkzeuge stellen die Stadt jedoch vor Herausforderungen. In Bonn stellen verschiedene Unternehmen bereits seit einigen Jahren ein vielfältiges Mobilitätsangebot bereit, das neben dem ÖPNV auch Carsharing, Bikesharing, Roller-Sharing und E-Scootersharing umfasst. Steuerung, Regulierung und Vernetzung des Angebots sind jedoch komplex. Eine Herausforderung für die Stadtverwaltung stellt vor allem der Umstand dar, dass die Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum angeboten und abgestellt werden – an diesen werden heutzutage aber auch noch ganz andere Ansprüche gestellt. So sind im Hinblick auf einen erlebenswerten öffentlichen Raum und die Teilhabe gerade für in ihrer Mobilität und Sehfähigkeit eingeschränkte Menschen etwa gut nutzbare, möglichst freie und barrierefreie Gehwege sehr wichtig. Zudem hat sich die Stadt Bonn mit der Frage auseinandergesetzt, wie den Shared-Mobility-Anbietern einfach, direkt und verbindlich vermittelt werden kann, in welchen Bereichen Fahrzeuge weder seitens der Anbietenden noch seitens der Nutzenden abgestellt werden dürfen. Dazu zählen beispielsweise die Fußgängerzonen, Park- und Grünanlagen sowie die Rheinuferbereiche. Andere Flächen können temporär hinzukommen, so etwa die Marktwiesen während des jährlich stattfindenden Volksfests „Pützchens Markt“.
Datenbasierte Entscheidungsgrundlage
Infolge der aktuellen Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen, die das Anbieten und Abstellen nicht stationsgebundener Mietfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum als Sondernutzung einstuft, steigt zudem der Bedarf für Instrumente zur Überprüfung und Evaluation dieser Sondernutzungen. So müssen beispielsweise Anzahl, Angebotsstandorte und Abstellorte von Fahrzeugen, für die eine Sondernutzungserlaubnis erteilt wurde und für die von den Anbietern entsprechende Gebühren gezahlt werden müssen, im Stadtgebiet systematisch erfasst und nachgehalten werden. Die genannten Herausforderungen adressiert das von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg initiierte Forschungsprojekt MIAAS (Mobility Intelligence as a Service). Es soll die Steuerung und Regulierung von Shared Mobility auf Basis von Mobilitätsdaten ermöglichen. Dazu werden Daten aller Anbieter zu einer standardisierten Entscheidungsgrundlage zusammengeführt und für die Stadt Bonn sowie die Mobilitätsdienstleister in Form eines webbasierten Dashboards nutzbar gemacht. Dieses stellt auch die benötigten Analysewerkzeuge zur Verfügung, um eine datengetriebene Entscheidungsfindung zur Planung der Gesamtmobilität zu ermöglichen. Das MIAAS-Dashboard beinhaltet eine Reihe von Modulen, die Anwendende bei Planung, Management und Optimierung der lokalen Sharing-Angebote unterstützen sollen. Aktuell lassen sich die bestehenden Module in die zwei Funktionsgruppen Monitoring und Regulierung unterteilen.
Monitoring und Regulierung
Beim Monitoring geht es zunächst darum, einen visuellen Überblick über die bestehenden Angebote zu schaffen. In erster Linie werden dabei aktuelle Fahrzeugpositionen in Echtzeit und in unterschiedlicher Form dargestellt. Dazu gehören die Module Vehicle Sharing und Echtzeitkarte. Zur Regulierung bestehender Angebote stehen Funktionen im Fokus, die es Nutzenden ermöglichen, bestimmte Zonen zu erstellen und an Sharing-Anbieter zu kommunizieren. Hierzu zählen die Module Parkverbotszonen und Mobilstationen. Über das MIAAS-Dashboard können Städte lokale Mobilitätsangebote unter anderem im Hinblick auf die Regeleinhaltung – wie die maximale Anzahl der Fahrzeuge oder Mindestanzahl der Fahrzeuge an bestimmten Orten – evaluieren oder etwa Parkverbotszonen festlegen. Die Anbieter wiederum rufen diese Daten ab und übermitteln ihrerseits der Stadt Daten, beispielsweise registrieren sie jedes neue Fahrzeug. Dafür setzt das Projekt auf Open-Source-Standards. Die bisherige Erprobung in der Stadt Bonn zeigt, dass ein solches Mobilitätsdashboard einen großen Mehrwert bei der Steuerung und Regulierung von kommunalen Mobilitätsangeboten bietet. So schafft die datenbasierte Betrachtung der Mobilität eine gute Grundlage für eine zielgerichtete Kommunikation zwischen allen Akteuren und ermöglicht somit auch eine effiziente Zusammenarbeit. Darüber hinaus hat die Stadt Bonn durch das Dashboard einen besseren Überblick über das lokale Mobilitätsangebot und dessen Nutzung. Die anbieterübergreifende Evaluation erlaubt zudem eine langfristige Bewertung und strategische Weiterentwicklung des Angebots. Eine weitere Erkenntnis des Feldtests: Durch die digitale Unterstützung der Regulierungsprozesse mithilfe von standardisierten Datenformaten entstehen auf allen Seiten Effizienzgewinne und somit auch Kostenersparnisse.
https://www.bonn.de
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe August 2024 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Kreis Traunstein: Weblösung reduziert Arbeitslast
[08.07.2025] Eine speziell auf die Verwaltung von Asylbewerbern, Unternehmen und gemeinnützigen Trägern ausgerichtete Weblösung unterstützt Kommunen bei der Koordination gemeinnütziger Aufgaben. Sie setzt auf Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI) und wurde gemeinsam mit dem Kreis Traunstein entwickelt. mehr...
Cadolzburg: Signieren ohne Tinte
[03.07.2025] Seit über einem Jahr nutzt die Marktgemeinde Cadolzburg den Signaturservice der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). Um Zertifikate selbstständig ausstellen und administrieren zu können, führte sie 2025 ergänzend das Zertifikatsportal des IT-Dienstleisters ein. mehr...
Digitale Souveränität: Ist die Schmerzgrenze erreicht?
[02.07.2025] Auf dem Zukunftskongress Staat & Verwaltung diskutierten Experten in der vergangenen Woche den aktuellen Stand bei der digitalen Souveränität. Diese ist durch geopolitische Verschiebungen wieder ins Blickfeld der Politik geraten. Ob die Marktdominanz von US-Konzernen bei Netzen und Software in der öffentlichen Verwaltung überwunden werden kann, erscheint indes weiter ungewiss. mehr...
KGSt: Kritik an Deutscher Verwaltungscloud
[01.07.2025] Die KGSt unterstützt die Deutsche Verwaltungscloud grundsätzlich – sieht aber Nachbesserungsbedarf bei Steuerung, Wirtschaftlichkeit und technischer Umsetzung. mehr...
Nordrhein-Westfalen: Digital-Index für das Ruhrgebiet
[01.07.2025] Erstmals wurde für die 53 Kommunen im Ruhrgebiet ein Digital-Index erstellt. Er nimmt verschiedene Themenfelder in den Blick, darunter die Bereiche Forschung, Beschäftigung, Unternehmen und Infrastruktur. Auch wurde das Gebiet mit elf anderen Metropolregionen in Deutschland verglichen. mehr...
Nürnberg: AutiSta aus der AKDB Cloud
[23.06.2025] Auf AutiSta als Software-as-a-Service bei der AKDB setzt die Stadt Nürnberg. Im Rahmen des Projekts hat die Frankenmetropole eng mit dem Fachverfahrenshersteller und dem IT-Dienstleister zusammengearbeitet. mehr...
GIS Consult / RIB IMS: CAFM-System mit GIS-Anbindung
[19.06.2025] Die Unternehmen RIB IMS und GIS Consult haben die bidirektionale Systemintegration der CAFM-Software RIB FM und des Geo-Informationssystems Smallworld GIS ausgeweitet. Flurstücke lassen sich somit grafisch visualisieren und darüber Prozesse für Verwaltungsaufgaben aller Art managen. mehr...
E-Rechnungspflicht: So gelingt die Umstellung
[17.06.2025] Mit der Einführung der E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich erwartet Kommunen ein deutlicher Anstieg eingehender E-Rechnungen. Angesichts dessen hat der Softwarehersteller xSuite sein Angebot in diesem Bereich ausgebaut und setzt dabei auch auf eine Cloudplattform. mehr...
Föhr-Amrum: Mit vereinten Kräften
[28.05.2025] Das Amt Föhr-Amrum hat vor rund einem Jahr eine Verwaltungskooperation mit dem Land Schleswig-Holstein getroffen. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. mehr...
IT.NRW: Basis der Modernisierung
[26.05.2025] Mit einer föderal anschlussfähigen Multi-Cloud-Architektur unterstützt IT.NRW den Aufbau interoperabler IT-Strukturen, entwickelt standardisierte Verwaltungsdienste und trägt zur sicheren Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus bei. mehr...
Freudenberg: Bürgerbüro arbeitet effizienter
[26.05.2025] Ein neues Terminvereinbarungs- und Besucherleitsystem optimiert in der Stadt Freudenberg die Arbeitsabläufe im Bürgerbüro. Das kommt nicht nur den Verwaltungsmitarbeitenden, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern zugute. mehr...
Hüttener Berge: Digitale Überzeugungstäter
[15.05.2025] Als eine der ersten Kommunen in Schleswig-Holstein hatte das Amt Hüttener Berge eine Digitalisierungsstrategie und hat inzwischen zahlreiche Maßnahmen seiner Digitalen Agenda umgesetzt. Die gewonnenen Erkenntnisse kommen auch anderen Kommunen zugute. mehr...
Ennepe-Ruhr-Kreis: Interkommunales Prozessmanagement
[14.05.2025] In einem interkommunalen Projekt widmen sich der Ennepe-Ruhr-Kreis und die Städte Witten, Hattingen, Gevelsberg, Wetter und Sprockhövel dem Prozessmanagement. Unter anderem wollen sie ein gemeinsames Prozessregister aufbauen. Der Austausch zwischen den Teilnehmenden ist ein zentraler Aspekt des Vorhabens. mehr...
Stuttgart: Plattform erleichtert Zusammenarbeit
[12.05.2025] Einfach, effizient und dennoch sicher soll die digitale Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung Stuttgart vonstatten gehen. Gleiches gilt für den Datenaustausch mit externen Partnern. Dafür setzt die baden-württembergische Landeshauptstadt nun eine Kollaborationsplattform ein. mehr...
Hannover: Schritt für Schritt zum Ziel
[30.04.2025] Die Verwaltungsdigitalisierung ist eine zentrale Herausforderung für Kommunen. Die Stadt Hannover zeigt, wie es mit einem Low-Code-Ansatz gelingen kann, Verwaltungsleistungen effizient zu digitalisieren und gleichzeitig interne Prozesse zu optimieren. mehr...