TUMSmart-City-Studie veröffentlicht
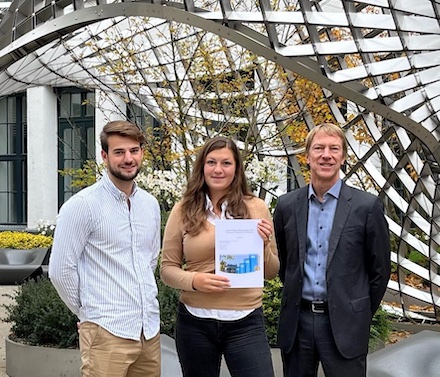
Das Team präsentiert die Smart-City-Studie der Technischen Universität München.
v.l.: Valentin Mayer, Projektstudent Smart-City an der Technischen Universität München; Lucia Baur, Studienleiterin; Prof. Joachim Henkel, Lehrstuhlinhaber für Technologie- und Innovationsmanagement an der Technischen Universität München
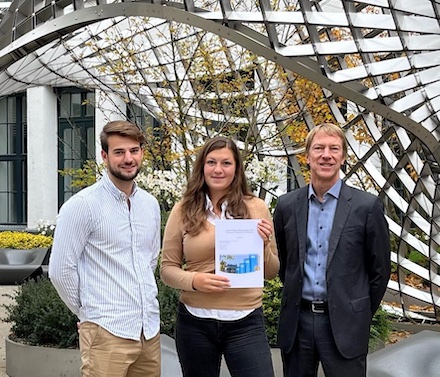
Das Team präsentiert die Smart-City-Studie der Technischen Universität München.
v.l.: Valentin Mayer, Projektstudent Smart-City an der Technischen Universität München; Lucia Baur, Studienleiterin; Prof. Joachim Henkel, Lehrstuhlinhaber für Technologie- und Innovationsmanagement an der Technischen Universität München
(Bildquelle: )
Eine Befragung von 107 deutschen Städten zum Thema Smart City hat jetzt ein Team rund um Professor Joachim Henkel, Lehrstuhlinhaber für Technologie- und Innovationsmanagement an der Technischen Universität München (TUM), und Studienleiterin Lucia Baur durchgeführt. Wie die TUM mitteilt, lautet eine Erkenntnis der Studie: Den Städten ist es besonders wichtig, bei der Kommunikationstechnologie – die den Datenfluss erst ermöglicht – die Netzwerke selbst gestalten und verwalten zu können. Finanzielle Gesichtspunkte spielten also eine untergeordnete Rolle, so auch bei der Zielsetzung des Smart-City-Engagements. Der Ruf als innovative und lebenswerte Stadt sowie effiziente städtische Abläufe zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger seien den Städten wichtiger als wirtschaftliche Aspekte.
Die Studie baue auf Erkenntnissen und Hypothesen aus knapp 20 Interviews auf, die im letzten Jahr vom Studien-Team mit deutschen Städten, Landkreisen, Stadtwerken sowie deren externen Dienstleistern geführt wurden. Zwischen Februar und April habe das Team die Antworten von 115 Expertinnen und Experten aus 107 Städten in einer Online-Umfrage erfasst. Zumeist hätten Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung diese Umfrage beantwortet, vereinzelt jedoch auch deren Technologiedienstleister oder die stadteigenen Stadtwerke. Die Teilnehmenden hätten auf Wunsch eine personalisierte Version des Studienreports zugesandt bekommen. Der allgemeine Report sei nun öffentlich verfügbar.
Unabhängigkeit von Dritten
„Wenn wir über Technologiewahl reden, denken wir klassischerweise an Kriterien, die vor allem technische Leistungsfaktoren beschreiben. Bei Kommunikationstechnologien sind dies beispielsweise die Datenrate, Übertragungsgeschwindigkeit oder Fehlerrate“, erläutert Lucia Baur und ergänzt: „Doch unsere Interviews vorab haben bereits angedeutet, dass im Kontext Smart City sehr wichtig ist, wer die Netzwerke betreibt und wie viel die Stadt selbst machen kann.“ Angaben der TUM zufolge zeigt sich in der Studie ein klares Bild: Die Top-Kriterien bei der Technologieauswahl seien IT-Sicherheit, niedriger Energieverbrauch und Unabhängigkeit von Dritten (80 Prozent aller Antworten bewerteten diesen Punkt als wichtig oder sehr wichtig). Ein Netz selbst oder durch die eigenen Stadtwerke zu betreiben, biete für Städte den Vorteil, alle Liegenschaften – beispielsweise auch schwer zugängliche Fernwärmeschächte – einfach selbst erschließen zu können. Allerdings seien hierfür Wissen und Erfahrung erforderlich und oft auch ein Notfallservice rund um die Uhr.
Klarer Favorit: LoRaWAN
Die Studie untersuche insbesondere den Bereich der Niedrigenergieweitnetzwerke (Low Power Wide Area Networks – LPWANs). Diese Netzwerke seien für städtische Anwendungen von großer Bedeutung, da Sensoren jahrelang mit einer einzigen Batterie funktionieren können, nur wenige Basisstationen zur Abdeckung des Stadtgebiets notwendig sind und die Kosten für derartige Netzwerke und Sensorik vergleichbar gering sind. In diesem Bereich seien drei technisch sehr ähnliche Technologien prominent und genau eine von ihnen – Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) – gestatte Städten den Eigenbetrieb. Die Studie zeige, dass knapp die Hälfte der teilnehmenden Städte (53 von 107) bereits LPWANs einsetzt. Konsistent zur hohen Priorisierung der Unabhängigkeit von Dritten als Auswahlkriterium zeige sich hier, dass in 40 Städten LoRaWAN bereits im Einsatz ist und weitere zwölf es in Planung haben. Narrowband-IoT, ein durch die großen Telekommunikationsunternehmen bereitgestelltes Netzwerk auf der Basis von Long Term Evolution (LTE), erfreue sich einer geringeren Beliebtheit und komme immerhin in sieben Städten zum Einsatz. Sigfox, das Netzwerk der gleichnamigen Firma mit Hauptsitz in Frankreich, sei mit nur drei Städten deutlich seltener vertreten. Die deutsche Smart City setze also in der Regel auf LoRaWAN und hierbei dominiere klar der Ansatz, das Netzwerk selbst zu betreiben; nur in acht Städten kämen externe Anbieter zum Zug.
Reputation und Standortattraktivität
Gefragt nach möglichen Bepreisungen werde deutlich, dass Städte das LoRaWAN meist kostenfrei bereitstellen möchten beziehungsweise schon bereitstellen – zumindest für eigene Zwecke (100 Prozent), innerhalb des Stadtkonzerns (62 Prozent) und für die Bürgerinnen und Bürger (65 Prozent). Unternehmen sollten nach mehrheitlicher Auffassung der Städte für die Nutzung des Netzes zahlen (59 Prozent). Trotzdem sehe die Mehrheit der Städte die Aussage „Smart City generiert zusätzliche Einnahmen für unsere Stadt“ kritisch – nur 25 von 93 (40 Prozent) stimmten hier zu. Finanzielle Gesichtspunkte seien also nicht die Vorteile, die Städte sich von der Smart City vorrangig erhoffen. Stattdessen sähen sie vor allem eine verbesserte Außenwirkung (90 Prozent Zustimmung), eine lebenswerte Stadt (89 Prozent Zustimmung) und eine bessere Ausführung städtischer Aufgaben als positive Effekte der Smart City. Städte, die bereits fortgeschritten sind bei der Umsetzung von Smart City, arbeiteten hierbei meist eng mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Genau hier biete die Studie Ansatzpunkte für Städte, die am Anfang der Umsetzung stehen. Weniger als die Hälfte aller teilnehmenden Städte nutze beispielsweise bislang die Möglichkeit, sich mit lokalen IT-Initiativen auszutauschen (nur 45 von 107, 42 Prozent).
Politische Dimension bewusst
Wenn auch im Kern natürlich die Netzinfrastruktur ein technisches Thema ist, so seien ihre politischen Auswirkungen nicht zu unterschätzen. Die Studie zeige, dass Städte sich durchaus der politischen Dimension dieser Technologieauswahl bewusst sind, wie auch die Dominanz von LoRaWAN zeigt. „Wir sehen aber auch, dass hinsichtlich der möglichen Nutzergruppen, der Vermarktung und bei dem technischen Setup des lokalen LoRaWANs ganz vielfältige Ansätze nebeneinander existieren. Wir erwarten hier in den kommenden Jahren ein Experimentieren, bis sich herauskristallisiert, welche Ansätze tatsächlich dauerhaft erfolgreich sind“, fasst die Studienleiterin Lucia Baur zusammen. Bei der praktischen Umsetzung von Smart City können viele Akteure von den fortschrittlichsten Städten lernen, heißt es seitens der TUM. Dabei seien einige Fragen noch offen und im öffentlichen Diskurs zu klären, beispielsweise die Notwendigkeit und praktische Umsetzung von Open Data.
Wolfsburg: City-Infosystem ersetzt Parkleitschilder
[12.02.2026] In Wolfsburg informieren jetzt smarte, frei programmierbare LED-Tafeln flexibel über freie Parkmöglichkeiten und den Verkehr in der Stadt und können auch darüber hinausgehende Hinweise ausstrahlen. Aus dem einstigen Parkleitsystem ist somit ein multifunktionales City-Informationssystem geworden. mehr...
Marpingen: Pilotprojekt für KI-gestütztes Straßenmanagement
[02.02.2026] In Marpingen werden Schäden an Straßen und Verkehrsschildern von kommunalen Fahrzeugen bei Alltagsfahrten per Smartphone erfasst. Eine KI-gestützte Open-Source-Lösung übernimmt die Aufbereitung der Daten. Bald soll die Lösung in 25 weiteren saarländischen Kommunen ausgerollt werden. mehr...
Kreis Hof: Werkzeug für Winterdienst
[29.01.2026] Taupunktsensoren unterstützen im Hofer Land den Winterdienst. Dabei agieren Kreis und angehörige Kommunen gemeinsam. Die Entscheidung über das Ausrücken, Streuen oder Räumen treffen trotz der umfassenden Daten weiterhin die Beschäftigten. mehr...
Smart Waste Hürth: Weltweites Leuchtturmprojekt
[27.01.2026] In Hürth messen Ultraschallsensoren den Füllstand öffentlicher Abfallbehältnisse und senden diese Daten an eine Künstliche Intelligenz. Die ermittelt, wann die Müllwagen welche Route nehmen sollten, um die Behälter zu leeren. Jetzt ist Smart Waste Hürth als weltweit sichtbares Leuchtturmprojekt ausgezeichnet worden. mehr...
Mannheim: Orientierung für barrierefreies Parken
[20.01.2026] In Mannheim steht eine neue, barrierefreie App für die Suche nach freien Schwerbehindertenparkplätzen zur Verfügung. Park-Stark nutzt Echtzeitdaten von über 250 Stellplätzen und zeigt Verfügbarkeit, Navigation und Alternativen direkt auf dem Smartphone an. mehr...
Mönchengladbach: Fünfter Smart City Summit Niederrhein
[20.01.2026] Mönchengladbach lädt am 26. Februar zur fünften Auflage des Smart City Summit Niederrhein ein. Mit Vorträgen, Workshops und einem großen Ausstellungsbereich richtet er sich an ein Fachpublikum, das sich mit der digitalen Transformation von Kommunen beschäftigt. Dabei werden strategische Perspektiven mit anschaulichen Praxisbeispielen verknüpft. mehr...
Beckum: BE smart
[09.01.2026] Konsequent treibt Beckum die Entwicklung zur Smart City voran. Beispielsweise bietet die Stadt mittlerweile ein digitales Bürgerbüro, eine Mängelmelder-App oder einen Kita-Navigator an. Einige ihrer Digitalisierungsprojekte stellt die Kommune nun in einer digitalen Broschüre und einem Kurzfilm vor. mehr...
Serie Digitalstädte: KI wird uns weiterhelfen
[08.01.2026] Die Ahauser Bürgermeisterin Karola Voß will im Bereich Wissensmanagement noch stärker auf Künstliche Intelligenz setzen und dadurch Ressourcen schonen. mehr...
Serie Digitalstädte: Mit Super-App unterwegs
[07.01.2026] In einer losen Serie stellt Kommune21 Digitalstädte mit Vorbildcharakter vor. Den Anfang macht Ahaus: Die nordrhein-westfälische Stadt ist ein Reallabor für digitale Anwendungen – mit einer Super-App als Schlüssel. mehr...
Kaiserslautern: Geordnete Liquidation von KL.digital
[06.01.2026] Die Stadt Kaiserslautern bereitet die geordnete Liquidation der KL.digital GmbH zum 30. Juni 2026 vor. An diesem Tag endet der Förderzeitraum der Modellprojekte Smart Cities, auf der die finanzielle Grundlage von KL.digital vollständig beruht. Die Projekte und Ideen sollen aber nahtlos in die Stadtverwaltung übergehen und dort weiterentwickelt werden. mehr...
Göttingen: Ausbau des städtischen Messnetzes
[22.12.2025] Ein Sensoriknetzwerk liefert der Stadt Göttingen wichtige Informationen über Wasserstände, die Baumgesundheit und die lokale Klimaentwicklung. Das Netz soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Die Daten sollen unter anderem in Forschung, Analysen und Planungsprozesse einfließen. mehr...
Frankfurt am Main: Digital Ressourcen schonen
[15.12.2025] Die Stadt Frankfurt am Main hat drei weitere Digitalisierungsprojekte umgesetzt: den Aufbau eines digitalen Wassermanagements, die Einführung der automatisierten Straßenzustandserfassung sowie die Open Library. Alle drei Projekte tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen. mehr...
Frankfurt am Main: Informiert zum Parkhaus
[12.12.2025] Viele Parkhausbelegungen in Frankfurt am Main sind jetzt in Echtzeit online einsehbar. Die erfassten Daten können von Verkehrstelematikanbietern oder Radiosendern für eigene Angebote abgerufen werden. Auch an die Mobilithek des Bundes werden sie übertragen. mehr...
Frankfurt am Main: Echtzeitdaten zum Weihnachtsmarkt
[05.12.2025] Ein Pilotprojekt mit LiDAR (Light Detection and Ranging)-Sensoren führt die Stadt Frankfurt am Main während des Weihnachtsmarkts am Römer durch. Die Sensoren messen dort das aktuelle Besucheraufkommen mit Laserstrahlen, die erfassten Daten stehen auf der urbanen Datenplattform in Echtzeit zur Verfügung. mehr...
Troisdorf: Smarter parken
[03.12.2025] Mit einer smarten Lösung bereitet Troisdorf der ineffizienten Parkraumbewirtschaftung ein Ende. Parksensoren erfassen jetzt die Belegung einzelner Stellplätze, die Bürgerinnen und Bürger werden darüber in Echtzeit per App informiert. mehr...























