FachverfahrenDie Digitalisierung stockt
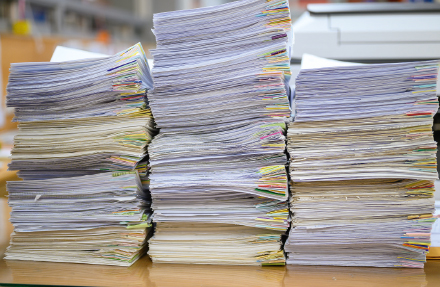
Digitale Melderegisterauskünfte würden viel Papier sparen.
(Bildquelle: mnirat/stock.adobe.com)
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) weckt bei Wirtschaft und Bürgern große Hoffnungen. „Bund und Länder sind verpflichtet … ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.“ So verkündet es vollmundig gleich der erste Paragraf des Gesetzes. Diese Pflicht erstreckt sich jedoch nur auf bereits vorhandene Verwaltungsleistungen. Sie geht dagegen nicht so weit, dass sinnvolle Verwaltungsleistungen neu geschaffen werden müssten.
Wer die aktuelle Anschrift eines Schuldners sucht, der im Bundesland Brandenburg wohnt, wird den Unterschied rasch begreifen. Praktisch wäre es für ihn, über ein zentrales Portal zu recherchieren, das alle Einwohner Brandenburgs nachweist. Den dafür notwendigen Datenbestand gibt es sogar, nämlich in Form des Landesmelderegisters. Allerdings ist ein Zugriff darauf ausdrücklich nur für Behörden möglich. Privatpersonen, auch Gläubigern, bleibt lediglich, sich an die rund 200 Meldebehörden des Landes zu wenden. Wohlgemerkt, an jede einzelne von ihnen. Manche Meldebehörden, etwa die Stadt Potsdam, bieten zumindest für ihr eigenes Melderegister eine Online-Melderegisterauskunft an. Die meisten tun dies aber nicht. Das OZG bietet dem vermutlich zunehmend verzweifelnden Gläubiger in dieser Situation lediglich einen dürftigen Trost. Alle Meldebehörden müssen künftig den Weg eröffnen, Anträge auf Melderegisterauskunft in elektronischer Form zu stellen. Dass die Auskünfte dann auch elektronisch erteilt werden müssten, ordnet das Gesetz jedoch nicht an. Briefpost von der Meldebehörde als Antwort reicht also auch künftig aus.
Nichtssagende Auskünfte und langwierige Prozeduren
Beim bedingten Sperrvermerk gab es seit der vergangenen RISER-Konferenz zum Meldewesen vor drei Jahren zumindest einen teilweisen Fortschritt. Um ihn einordnen zu können, sei noch einmal vor Augen geführt, was ein bedingter Sperrvermerk bewirkt. Er verhindert insbesondere, dass eine einfache Melderegisterauskunft elektronisch erteilt werden kann. Anstelle einer Antwort auf seinen Antrag erhält der Antragsteller eine neutrale, sprich: nichtssagende Auskunft. Sie lässt völlig offen, ob der Einwohner nicht gefunden wurde oder ob sich vor einer etwaigen Auskunft erst noch ein individuelles Prüfungsverfahren anschließt. Dieses beginnt mit einer Anhörung des Betroffenen auf dem Postweg. Erst danach entscheidet die Meldebehörde, ob sie die Auskunft erteilt. Die gesamte Prozedur zieht sich dabei regelmäßig über vier bis sechs Wochen hin. Eingetragen wird der bedingte Sperrvermerk von Amts wegen – also ohne Antrag der betroffenen Person – für Einwohner in bestimmten Einrichtungen. Zwar wurden die Justizvollzugsanstalten zum April dieses Jahres aus der Liste der Einrichtungen herausgenommen, bei denen bedingte Sperrvermerke einzutragen sind. Für Bewohner und Bewohnerinnen von Pflegeheimen ist er allerdings erhalten geblieben. Je älter die Bevölkerung im Durchschnitt wird, desto größer wird diese Personengruppe. Ihr gesundheitlicher Zustand ist oft ausgesprochen schwierig. Ein Anhörungsschreiben der Meldebehörde können die Betroffenen persönlich so gut wie nie beantworten. Es kommt in der Praxis zudem allenfalls in exotischen Einzelfällen vor, dass der Bewohner eines Pflegeheims etwas vorzutragen wüsste, das einer einfachen Melderegisterauskunft entgegenstehen könnte. Dennoch beharrt der Gesetzgeber bisher darauf, dass für diese Menschen ein bedingter Sperrvermerk einzutragen ist.
„Gut gemeint“ bedeutet nicht immer „gut gemacht“
Dass „gut gemeint“ nicht immer „gut gemacht“ bedeutet, könnte sich rasch bei der Auskunftssperre wegen Gefährdung zeigen. Bislang legen die Gerichte bei den Voraussetzungen für eine solche Sperre strenge Maßstäbe an. Ihr völlig zutreffendes Argument: Eine Häufung von Auskunftssperren gefährdet tendenziell die Funktionsfähigkeit der Melderegister. Gerade diese strikte Rechtsprechung war für den Gesetzgeber Anlass, die Maßstäbe für die Eintragung einer Auskunftssperre zu senken. Künftig soll ausdrücklich berücksichtigt werden, ob der Antragsteller einem Personenkreis angehört, der „allgemein in einem verstärkten Maß Anfeindungen ausgesetzt ist“. Das zielt vor allem auf die Gruppe der Kommunalpolitiker. Der Gesetzgeber sieht mit Sorge, dass sie zum Teil übelsten Drohungen ausgesetzt sind. Selbst tätliche Übergriffe kommen immer wieder vor. Kommunalpolitikerinnen und -politiker sollen künftig deutlich leichter als bisher eine Auskunftssperre wegen Gefährdung erhalten können.
Sie werden in der neuen Regelung allerdings nicht ausdrücklich als die Personengruppe genannt, um die es geht. Vielmehr hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen für eine Auskunftssperre wegen Gefährdung allgemein aufgeweicht. Zu fürchten ist, dass sich bald alle möglichen Personengruppen bedroht fühlen. Zudem erscheint es nicht realistisch, dass eine Auskunftssperre gerade einen Kommunalpolitiker effektiv schützen könnte. Wirklich helfen würde stattdessen eine konsequente Strafverfolgung im Einzelfall. Sie lässt sich nicht durch eine Auskunftssperre wegen Gefährdung ersetzen.
Problematische Entwicklungen im Meldewesen, die der Diskussion bedürfen, gibt es also genug. Nicht vergessen sollte man darüber, welche Leistungen die Meldebehörden jeden Tag für die Allgemeinheit erbringen. Zahlreiche elektronische Auskünfte an Sicherheitsbehörden haben schon oft zu Ermittlungserfolgen beigetragen. Und automatische Datenübermittlungen an weitere Behörden ersparen den Bürgerinnen und Bürgern viel Schriftverkehr. Diese Erfolge gilt es zu sichern und auszubauen.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe November 2021 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Advertorial: Low Code vereinfacht interkommunale Zusammenarbeit
[19.02.2026] Digitale Fachverfahren müssen heute schneller, flexibler und wirtschaftlicher entstehen – doch klassische Entwicklungsprozesse bremsen viele Verwaltungen aus. Die Low-Code-Anwendung OutSystems verschafft Abhilfe. mehr...
Bayern: Digitale Bauleitplanung flächendeckend
[17.02.2026] Die digitale Bauleitplanungs- und Beteiligungsplattform DiPlanung ist in Bayern landesweit verfügbar. Informations- und Schulungsangebote erleichtern Kommunen den Einstieg. Ein Förderprogramm unterstützt sie zudem dabei, Planungen im Standard XPlanung umzusetzen. mehr...
Kiel: Digitales Verfahren zur Geburtsanzeige
[12.02.2026] Die in Kiel realisierte elektronische Geburtsanzeige zeigt, was Digitalisierung ermöglicht: Kliniken und Hebammen sparen Zeit und vermeiden doppelte Eingaben, die Eltern bekommen Urkunden automatisch zugeschickt und Mitarbeitende des Standesamts können Anzeigen schneller prüfen und bearbeiten. mehr...
Rostock: Pilot für digitalen Bauantrag
[11.02.2026] Schluss mit Papierakten und Postwegen: Rostock startet als Pilotkommune den Digitalen Bauantrag in Mecklenburg-Vorpommern – ein organisatorisch und technisch anspruchsvolles Großprojekt. mehr...
Nordrhein-Westfalen: Fischereischein auf dem Smartphone
[10.02.2026] In Nordrhein-Westfalen können Fischereischeine ab Juli dieses Jahres auch online beantragt werden – und werden außerdem im neuen Scheckkartenformat und als elektronische Zertifikate auf dem Smartphone ausgegeben. mehr...
Praxis-Webinar: Digitale Entlastung für Jobcenter
[09.02.2026] Typische Herausforderungen im Jobcenter-Alltag und wie diese mit der Einführung einer digitalen Lösung zur Besuchersteuerung gemeistert werden können, stehen im Fokus eines Online-Webinars von SMART CJM gemeinsam mit dem Jobcenter des Landkreises Esslingen. mehr...
Kita-Lösungen: Neue Anwender für Little Bird
[05.02.2026] Das Unternehmen Little Bird hat zum Jahresauftakt zehn neue Kunden gewonnen: von Bautzen in Sachsen bis Lindau am Bodensee in Bayern ist der digitale Neustart in der Kinderbetreuung in vollem Gange. mehr...
Nordrhein-Westfalen: BAföG-Fachverfahren fürs ganze Land
[02.02.2026] In Nordrhein-Westfalen wird das Gros der Anträge auf BAföG und Aufstiegs-BAföG per Post oder E-Mail eingereicht. Nun soll ein neues Fachverfahren eingeführt werden – landesweit. Den Auftrag erhielt die Firma Datagroup. mehr...
Darmstadt: Fahrerlaubnisbehörde nimmt Fahrt auf
[02.02.2026] Mit neuen Strukturen und digitalen Angeboten konnte die Fahrerlaubnisbehörde in Darmstadt ihre Servicequalität erhöhen. Mehrere Onlineanträge, die vorherige Terminvereinbarung für den Behördenbesuch und eine digitale Schnittstelle zum TÜV-Hessen straffen dort nun die Abläufe. mehr...
VG Polling: Biometric Go ergänzt PointID
[26.01.2026] In Polling können biometrische Passbilder direkt auf dem Amt erstellt werden. Die Verwaltungsgemeinschaft bietet dafür die PointID-Geräte der Bundesdruckerei an. Um Babys und Kleinkinder ablichten zu können, greift sie auf die mobile Fotolösung Biometric Go zurück. Beide Aufnahmegeräte überstellen die Bilder direkt ins Fachverfahren des Einwohnermeldeamts. mehr...
AKDB: adebisKITA als Cloud-Version
[26.01.2026] Als Cloud-Version soll die Software adebisKITA noch besser bei der Verwaltung von Kindertagesstätten unterstützen. Eine intuitive Bedienbarkeit und zeitgemäße Visualisierung sollen dazu ebenso beitragen wie die grundlegend neu gedachten Prozesse in der webbasierten Version. mehr...
Düsseldorf: Terminagent erfüllt Wünsche
[23.01.2026] In Düsseldorf stand das Amt für Einwohnerwesen lange vor der Herausforderung, den Bürgerservice effizient und gleichzeitig bürgerfreundlich zu gestalten. Gelungen ist das der Stadt mithilfe eines Terminagenten. mehr...
Kreis Steinfurt: Bauantrag ohne Papier
[14.01.2026] Das Bauportal Nordrhein-Westfalen ist um eine Kommunikationsplattform ergänzt worden, sodass auch der Austausch rund um einen Bauantrag digital abgewickelt werden kann. Als erster Landkreis startet Steinfurt mit dem voll digitalisierten Verfahren. mehr...
Hamm: Schub für digitale Genehmigungen
[12.01.2026] Die Stadt Hamm bearbeitet Bau- und Immissionsschutzanträge künftig Ende-zu-Ende digital. Digitale Einreichungen werden vollständig elektronisch geprüft und beschieden. Mit gezielten Anreizen und Informationsangeboten will die Stadt den Wechsel von Papier- zu Digitalanträgen beschleunigen. mehr...
Bremerhaven: Schulgebäude smart gebaut
[16.12.2025] Die Stadt Bremerhaven setzt beim Hochbauprojekt „Allianz 3 Schulen“ auf smarte Methoden wie Building Information Modeling, um Prozesse effizienter und präziser zu gestalten. Zudem kommt das innovative Verfahren der integrierten Projektallianz (IPA) zum Einsatz. mehr...






















