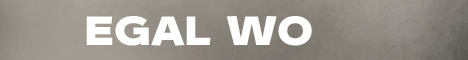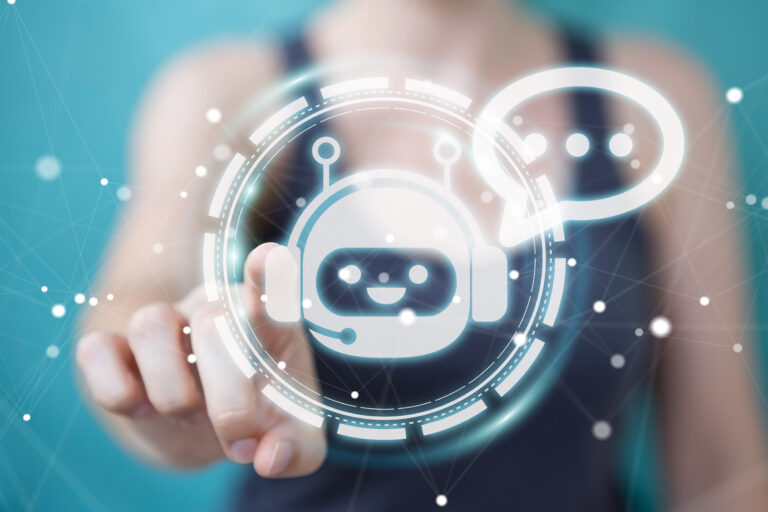Digitale TelefonassistenzMehr KI, weniger Wartezeit
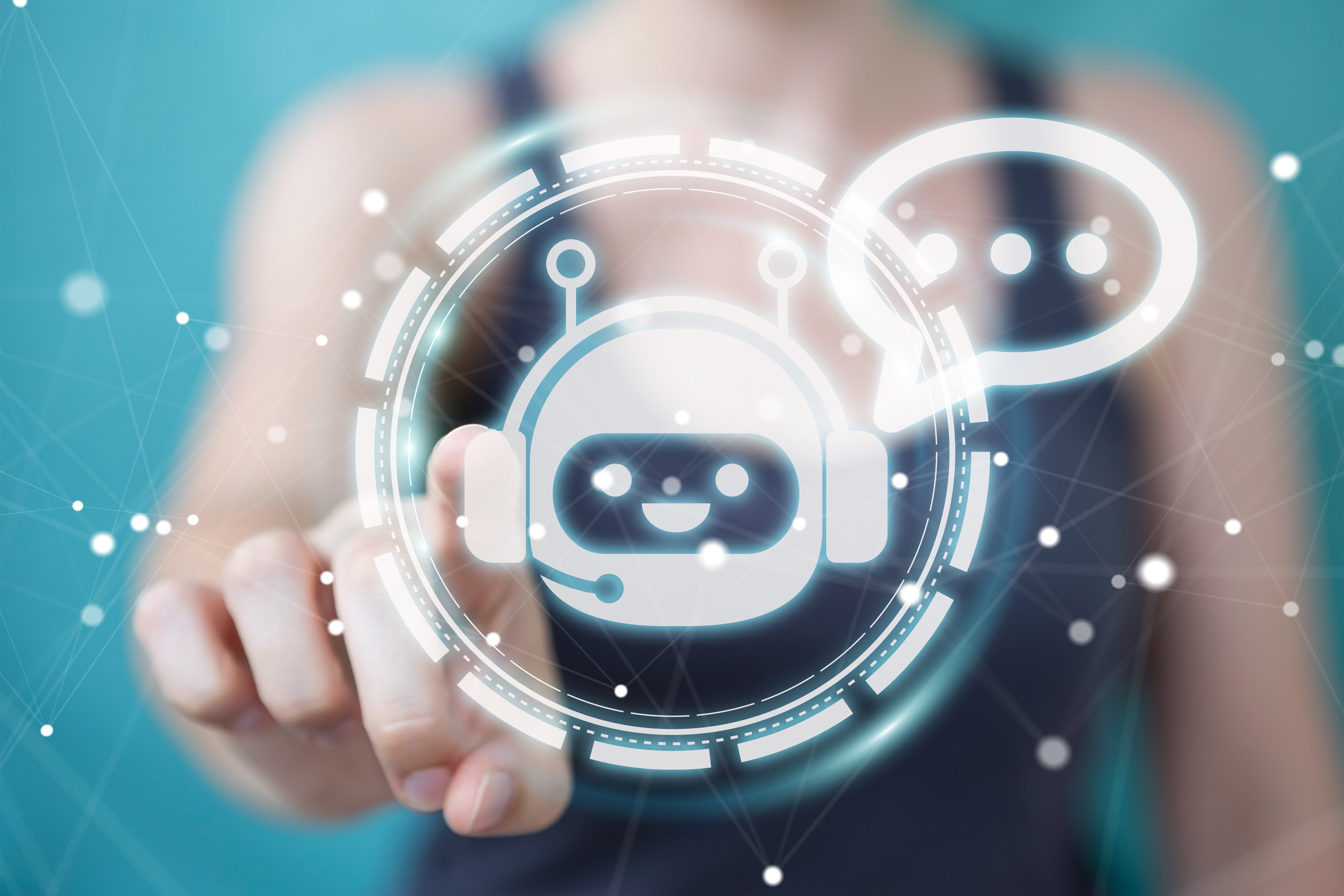
Voicebots arbeiten rund um die Uhr und können mehrere Sprachen sprechen und verstehen.
(Bildquelle: sdecoret/123rf.com)
Wenn Anruferinnen und Anrufer in der Warteschleife eines Bürgertelefons hängen, liegt das selten am mangelnden Willen der Verwaltung. Viel häufiger fehlen dieser schlichtweg die nötigen Kapazitäten, um unmittelbar reagieren zu können. Dazu trägt nicht nur der Fachkräftemangel bei. Auch knappe finanzielle Mittel und immer neue gesetzliche Aufgaben belasten die Kommunen dauerhaft. Erleichterung versprechen so genannte Voicebots. In den Callcentern großer Unternehmen gehören die automatisierten Telefonassistenten bereits zum Alltag. Daran nehmen sich immer mehr Kommunen ein Beispiel und greifen ebenfalls auf diese Art der Unterstützung zurück.
Voicebots übernehmen Aufgaben, deren Inhalte klar strukturiert sind. Dazu zählen Auskünfte zu Öffnungszeiten ebenso wie Informationen zu Gebühren oder der Bearbeitungsstand von Anliegen. Die Bots beantworten solche Fragen der Anrufer rund um die Uhr direkt und in natürlicher Sprache. Wenn der Bot auf die entsprechenden IT-Systeme zugreifen kann, kann er auf Wunsch des Anrufers sogar einen Termin für den Gang zum Amt buchen – fehlerfrei und ohne menschliches Zutun. Darüber hinaus können Voicebots verschiedene Sprachen sprechen und verstehen. Dadurch sorgen sie für eine Flexibilität und Kundennähe, wie sie herkömmliche Hotlines kaum bieten können.
Sprache verstehen und verarbeiten
Um gesprochene Sprache zu analysieren, nutzen Voicebots unterschiedliche KI-Methoden, darunter die Intent-Erkennung und Large Language Models. Dabei erkennen sie Muster, beispielsweise beim Satzbau, der Intonation oder dem Kontext. Das versetzt die Bots in die Lage, einfache Anliegen automatisiert bearbeiten zu können. Sie können außerdem auf verschiedene Formulierungen, Dialekte oder Sprechweisen reagieren.
Die KI-Modelle werden mit umfangreichen Sprachdaten trainiert und durch maschinelles Lernen (ML) kontinuierlich verbessert. In vielen Branchen helfen zusätzliche Trainings, etwa durch domänenspezifische Feinabstimmung oder synthetische Daten via Data Augmentation, ein Verfahren, das aus begrenzten Beispielen zusätzliche Trainingsdaten generiert. Denn jeder Anwendungsfall stellt eigene Anforderungen an den Telefonassistenten. Wird ein Anrufer nicht richtig verstanden, ist ein KI-Bot schnell eher hinderlich als hilfreich.
Nicht alle Voicebots basieren ausschließlich auf Künstlicher Intelligenz. Es gibt auch hybride Systeme, welche die KI mit regelbasierten Dialogstrukturen kombinieren. Eine solche Lösung ermöglicht einerseits die effiziente Reaktion auf vorhersehbare Abläufe. Andererseits kann flexibel mit Abweichungen umgegangen werden. Das ist beispielsweise bei komplexen Verwaltungsprozessen ein Vorteil.
Die passenden Rahmenbedingungen
Damit ein Voicebot tatsächlich nützlich ist, müssen neben einer guten Sprachtechnologie weitere Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu zählen klare Zuständigkeiten in der jeweiligen Verwaltung. Wenn eine Kommune ein neues Voicebot-System einführen möchte, braucht es eine verantwortliche Person oder ein Team, die das Projekt koordinieren, die Pflege der Inhalte sicherstellen und als Ansprechpartner für alle dienen. Ohne diese zentrale Anlaufstelle droht das System zu scheitern. Zudem muss die Lösung an bestehende Systeme angebunden werden. Denn ohne den Zugriff auf Daten zum Beispiel aus dem Content-Management-System (CMS) kann ein Voicebot nur wenig ausrichten. Je stärker er in die Systemlandschaft integriert ist, desto besser kann er helfen.
Zu bedenken ist des Weiteren der Datenschutz. Sobald Künstliche Intelligenz und sensible Daten im Spiel sind, müssen Kommunen besondere Vorsicht walten lassen. Gleich zu Beginn gilt es zu klären, wo die Daten liegen, wer die Daten verarbeitet und welches KI-Modell auf die Daten zugreifen kann. Besonders gefragt sind Lösungen, bei denen Kommunen die volle Hoheit über ihre Sprach- und Textdaten behalten. Mehrere Anbieter setzen hier auf eine verschlüsselte Verarbeitung in europäischen Cloudumgebungen, um die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu erfüllen.
Realistische Erwartungen, konkreter Nutzen
Einige Kommunen setzen bereits seit Längerem Voicebots ein. Während der Corona-Pandemie beantworteten die digitalen Assistenten beispielsweise telefonische Anfragen zu Verordnungen, Impfungen oder Teststellen. Karlsruhe konnte so zeitweise über zwei Drittel der Anrufe automatisiert bearbeiten. Nach der Pandemie wurde die Lösung auf andere Bereiche wie das Einwohnermeldewesen ausgeweitet – mit positiven Rückmeldungen aus Bevölkerung und Verwaltung.
Heidelberg hat ebenfalls Erfahrungen mit dieser modernen Kommunikationsart gesammelt. Der Bot war dort an die bestehende Infrastruktur angebunden und wurde gezielt auf häufige Anfragen trainiert. Der Schlüssel zum Erfolg waren realistische Erwartungen, ein klarer Projektfokus und eine technische Lösung, bei der klar definiert war, wo welche Daten sicher gespeichert werden.
Voicebots oder KI-Agenten sind kein Ersatz für eine persönliche Beratung. Das sollen sie auch nicht sein. Vielmehr sind sie ein Werkzeug, mit dem wiederkehrende Aufgaben effizienter erledigt werden können, wodurch mehr Spielraum für komplexere Anliegen entsteht. Entscheidend ist, dass die Bots nicht als Hype-Technologie, sondern als Teil einer strategischen Digitalisierungsplanung verstanden werden. Wer Prozesse, Inhalte und die Datenbasis im Griff hat, kann mit KI im Allgemeinen und einem Voicebot im Besonderen viel erreichen – und damit auch ein Stück Bürgernähe zurückgewinnen.
Leipzig: KI-Fuchs spürt Wissen auf
[28.01.2026] Leipzig setzt mit dem KI-Fuchs neue Maßstäbe im Wissensmanagement. Das auf Open Source basierende System kombiniert ein multimodales Sprachmodell mit internem Verwaltungswissen, schafft damit Effizienzgewinne und deckt Bürokratieabbau-Potenziale auf. mehr...
Düsseldorf: Voicebot Kira antwortet für’s Steueramt
[26.01.2026] Seit einem guten halben Jahr unterstützt die Künstliche Intelligenz für Rückfragen & Auskünfte Kira das Düsseldorfer Steueramt bei telefonischen Anfragen zur Beherbergungssteuer. Nun wurden die Fähigkeiten der virtuellen Sprachassistentin erweitert, sodass sie auch zur Grundsteuer Auskunft geben kann. mehr...
Mitarbeiterqualifizierung: Fit für KI
[19.01.2026] Arbeitsentlastung, effiziente Verwaltungsabläufe und besserer Bürgerservice – KI hat das Potenzial, zentrale Herausforderungen des öffentlichen Sektors zu lösen. Ein modulares Qualifizierungsangebot von Ewerk unterstützt Verwaltungsmitarbeitende beim Umgang mit KI-Systemen. mehr...
Tobit.Software: KI-Serverlösung für KAAW-Kommunen
[14.01.2026] Gemeinsam erleichtern das Unternehmen Tobit.Software und die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) Kommunen in den Kreisen Borken und Steinfurt die Arbeit mit Künstlicher Intelligenz: Die Verwaltungen erhalten Zugang zum SideKick Server, der verschiedene KI-Sprachmodelle vereint und hohe datenschutzrechtliche Anforderungen erfüllt. mehr...
KI-Agenten: Digitale Assistenten
[13.01.2026] KI-Assistenten sollen den Mitarbeitenden in der Verwaltung beim Durchführen von Routinetätigkeiten behilflich sein. Bei einigen Vorreiterkommunen kommen sie bereits zum Einsatz. Die ersten Anwendungen nehmen sich durchaus vielversprechend aus. mehr...
Bochum: Eigens entwickelter ChatBOt
[12.01.2026] Auf der Bochumer Website unterstützt der neue ChatBOt die Bürgerinnen und Bürger bei der Suche nach Informationen über Dienstleistungen der Stadtverwaltung. Der digitale Assistent ist vollständig intern entwickelt worden und kann dank modernem KI-Ansatz auch natürliche Sprache verstehen. mehr...
Stade: Käpt’n Knut nimmt den Dienst auf
[08.01.2026] In der Hansestadt Stade ist jetzt der KI-Chatbot Käpt’n Knut an Bord. Die Verwaltung freut sich über Feedback zu dem Angebot, das perspektivisch auch telefonisch genutzt werden kann. mehr...
Hagen: Städtische Internetseite wird polyglott
[07.01.2026] Die Stadt Hagen stellt große Teile ihrer Webseite jetzt auch in fremdsprachiger Version zur Verfügung. Eine komplexe mehrsprachige Seitenstruktur im Back End und aufwendiges Aktualisieren sind dazu nicht notwendig: Zum Einsatz kommt die leicht integrierbare Lösung Conword. mehr...
Kreis Borken: Chatbot BOR.KI ist im Dienst
[05.01.2026] Auf der Website des Kreises Borken beantwortet jetzt Chatbot BOR.KI die Anfragen der Bürgerinnen und Bürger. Die Künstliche Intelligenz (KI) greift dafür auf die Inhalte der Internetseite zurück und beantwortet Fragen nur zu jenen Dienstleistungen, für die die Kreisverwaltung tatsächlich zuständig ist. mehr...
Rechtsinformationen: Die Informationsflut bändigen
[18.12.2025] Die öffentliche Verwaltung steht vor immer komplexeren Rechtsanforderungen bei gleichzeitig schrumpfenden Personalressourcen. KI-gestützte Lösungen können helfen, Rechtsinformationen automatisch aufzubereiten und in der Fallbearbeitung bereitzustellen. mehr...
SMARD-GOV: Datenschutzkonforme LLMs für Behörden
[18.12.2025] Im Forschungsprojekt SMARD-GOV werden datenschutzkonforme Large Language Models (LLMs) für den Einsatz in Behörden untersucht. Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die Universität Münster (UM) sowie das Software- und Beratungsunternehmen Prosoz nehmen dafür sowohl technische als auch rechtliche Aspekte in den Blick. Im Fokus stehen Anwendungen bei Bauanträgen. mehr...
Unterschleißheim: Chatbot statt Formularwüste
[18.12.2025] Die Stadt Unterschleißheim bietet den Bürgerinnen und Bürgern mit Civic Forma jetzt den Prototyp einer KI-gestützten Lösung an, die sie Schritt für Schritt durch amtliche Formulare führt. Der KI-Assistent kann Rückfragen beantworten und mehrere Sprachen übersetzen. Die Übersetzungen werden dann ins Deutsche übertragen und in das Formular übernommen. mehr...
S-Public Services: KI als Lotse im Formular-Dschungel
[17.12.2025] KI unterstützt schon heute die Arbeit mit Online-Anträgen in der kommunalen Verwaltung und erleichtert und beschleunigt das Ausfüllen. Zugleich eröffnet KI-gestützte Antragserfassung ein großes Potenzial für Automatisierung. mehr...
Vitako/KGSt: KI-Strategie für Kommunen
[11.12.2025] Vitako und KGSt haben gemeinsam eine praxisbezogene Arbeitshilfe veröffentlicht, die Kommunen dabei unterstützt, den hochdynamischen Wandel durch generative Künstliche Intelligenz aktiv und verantwortungsvoll zu gestalten. mehr...
Digitale Barrierefreiheit: KI-Avatare sprechen Gebärdensprache
[10.12.2025] Das Unternehmen alangu hat sich auf die Entwicklung von KI-gestützten 3D-Gebärdensprach-Avataren spezialisiert, um gehörlosen Menschen den Zugang zur digitalen Welt zu erleichtern. Geschäftsführer Alexander Stricker erklärt im Gespräch mit Kommune21, wie aus einer Forschungsinitiative ein innovatives Produkt entstanden ist, das Kommunen und Organisationen bei der inklusiven Digitalisierung unterstützt. mehr...