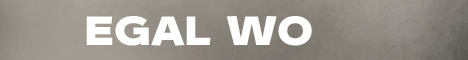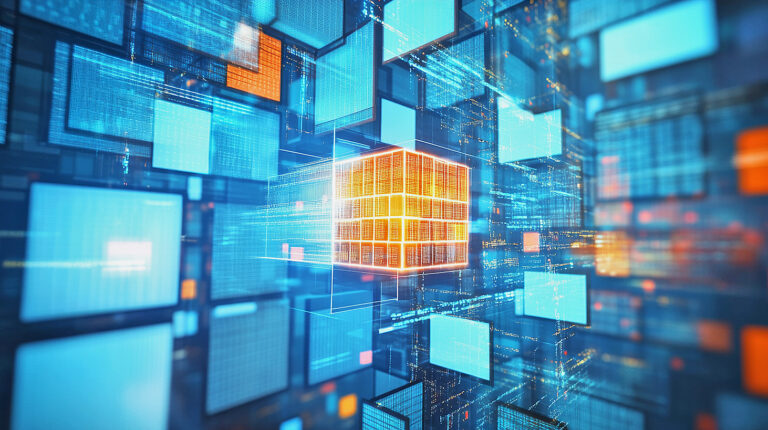Urbane DatenplattformenWichtiger Schlüssel

Urbane Datenplattformen fungieren als zentrale Datendrehscheibe.
(Bildquelle: Panuwat/stock.adobe.com)
Kommunen weltweit begegnen täglich vielen verschiedenen Herausforderungen, beispielsweise in den Bereichen Verkehrsüberlastung, Luftverschmutzung, Klimaanpassung oder sozialer Ungleichheit. Digitale Technologien ermöglichen durch vorausschauende Steuerung oder Planung kommunaler Prozesse die Lösung dieser Probleme und befähigen zur Schaffung völlig neuer Dienstleistungen – sie benötigen jedoch eine fundierte Datenbasis, für deren Bereitstellung sich urbane Datenplattformen (UDP) anbieten. Diese fungieren als Datendrehscheibe – sie integrieren unterschiedlichste Daten verschiedener Quellen und stellen diese anderen Systemen zentral zur Verfügung.
In Verbindung mit Smart Services oder Digitalen Zwillingen können die Daten für Simulationen und neue Lösungen genutzt werden und ermöglichen fundierte, nachvollziehbare Entscheidungen. Damit unterstützen urbane Datenplattformen die nachhaltige Entwicklung von Kommunen. Städte können durch deren Nutzung effizienter agieren und Bürgerinnen und Bürger aktiv in den Gestaltungsprozess einbeziehen, um auf diesem Wege eine lebenswertere Umgebung zu schaffen.
Technologisch unterscheiden sich UDP nach ihren Spezialisierungen, etwa auf Themen wie Open Data, Internet of Things, Big Data oder Geodaten. Generell müssen urbane Datenplattformen aber verschiedene Arten kommunaler Daten verarbeiten können. Hochspezialisierte Datenplattformen, etwa für Geodaten allein, kann man nicht als echte UDP bezeichnen.
Konkrete Ziele setzen
Die Einführung einer UDP birgt für Kommunen viele Chancen und Mehrwerte. So ermöglicht die zentrale Datenbereitstellung mittels UDP datenbasierte Analysen sowie das Verschneiden von Daten verschiedener Domänen, um fundierte Entscheidungen und neue Einsichten zu unterstützen, beispielsweise in der Stadtplanung und -entwicklung. Darüber hinaus lässt sich mit einer UDP Interoperabilität herstellen, sie kann die Effizienz kommunaler Arbeit und der Bürgerbeteiligung steigern, dient der Innovationsförderung und verbessert Nachhaltigkeit sowie Lebensqualität.
Dem stehen jedoch auch einige Herausforderungen gegenüber. Dazu gehört unter anderem, Datenschutz und Datensicherheit sicherzustellen und die Datenqualität zu gewährleisten. Zudem gilt es, Daten verschiedener Systeme zu integrieren, die komplexe Entwicklung und Wartung der technischen Infrastrukturen zu bewältigen sowie finanzielle und personelle Ressourcen für die Wartung und den Betrieb der UDP sicherzustellen. Zu guter Letzt muss bei Bürgerinnen und Bürgern Akzeptanz für die Plattform geschaffen werden.
Wichtig bei der Auswahl und Einführung einer urbanen Datenplattform ist die Zieldefinition der Kommune: Was soll durch die Einführung erreicht werden? Für die Datenplattform sollten konkrete Ziele gesetzt werden, sodass sie allen Akteuren einen Nutzen bringt und auch die notwendigen Zuarbeiten klar werden. Dieses Vorgehen hilft, ein gemeinsames Verständnis für einheitliche Datenstandards und -qualität zu etablieren, um eine möglichst hohe Nutzbarkeit von Daten zu ermöglichen.
Anforderungen zusammentragen
Seit Veröffentlichung der Publikation „Urbane Datenplattformen“ im Jahr 2023 hat sich einiges getan. So wird derzeit die im Jahr 2017 veröffentlichte DIN SPEC 91357, die den weiten Kontext über kommunale digitale Ökosysteme spannt, mit der DIN SPEC 91377 konkretisiert. Diese DIN SPEC mit dem Titel „Datenmodelle und Protokolle in offenen urbanen Plattformen“ benennt nicht nur relevante Datenformate und Protokolle, die durch UDP unterstützt werden sollten. Sie schärft auch den Blick für Aufgaben, Funktionen und Architektur von UDP im kommunalen Ökosystem.
Die Sicherheit urbaner Datenplattformen hat in den vergangenen Monaten zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Sie ist besonders relevant, da diese Plattformen häufig sensible Daten speichern, beispielsweise Informationen zu den sozialen Strukturen in verschiedenen Bereichen einer Stadt oder zu kommunalen Infrastrukturen. Die Sicherheit von Datenplattformen ist vor allem wichtig, wenn sie zu sicherheitskritischen Zwecken eingesetzt werden. Dann stehen neben der Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten vor allem die Integrität sowie die Verfügbarkeit im Fokus.
Um die Sicherheit urbaner Datenplattformen zu stärken, hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Ende Februar 2025 die technische Richtlinie TR-03187 veröffentlicht. Diese definiert spezifische Sicherheitsanforderungen an UDP und deren Betrieb, wodurch typische Schwächen beim Einsatz dieser Plattformen vermieden werden sollen.
Zur Einführung einer urbanen Datenplattform sollten zunächst im Rahmen einer Konzeptionsphase die Ziele und Anwendungsfälle der Kommune identifiziert werden, um daraus Anforderungen ableiten zu können. Die Konkretisierung möglicher Anwendungsfälle dient auch dazu, die Datenplattform greifbar zu machen und den Nutzen einer solchen Investition zu zeigen. Da sich eine UDP in die kommunale IT-Infrastruktur einfügen muss, ist eine frühzeitige Einbindung der IT-Abteilung und die Dokumentation existierender Systeme und Schnittstellen unabdingbar. Sind alle Anforderungen an die Lösung gesammelt, stellen sich für Kommunen weitere Fragen für die Planung oder Ausschreibung. Diese umfassen Entwicklungs- und Betreibermodell sowie die Wahl des Lizenzmodells.
Entwicklungs-, Betreiber- und Lizenzmodelle
Beim Entwicklungsmodell kommen im Wesentlichen Eigenentwicklung, Entwicklungspartnerschaft oder Fremdbezug einer etablierten Lösung infrage. Während die Eigenentwicklung eine maßgeschneiderte Lösung liefert, jedoch ressourcenintensiv ist, können bei Entwicklungspartnerschaften Synergien entstehen und Entwicklungskosten geteilt werden – zu Lasten einer intensiveren Koordination. Bei einem Fremdbezug kann unmittelbar auf hohe externe Kompetenz zugegriffen werden, jedoch ist die Gefahr von Abhängigkeiten zu einem Anbieter gegeben.
Mögliche Betreibermodelle sind der Eigenbetrieb, der Betrieb im kommunalen Rechenzentrum oder der Betrieb durch spezialisierte externe Anbieter. Während mit dem Eigenbetrieb das höchste Maß an Datensouveränität einhergeht, entstehen auch hohe Ressourcenaufwände. Bei der Wahl eines externen Dienstleisters mit entsprechenden Kompetenzen reduziert sich dieser Aufwand zu Lasten der eigenen digitalen Souveränität. Hinsichtlich des Lizenzmodells bieten Open-Source-Lösungen eine höhere Akzeptanz in Projekten mit öffentlicher Förderung und lassen mehr Zukunftssicherheit bei geringerer Anbieterabhängigkeit erwarten. Zudem erleichtert Open-Source-Software die Nachnutzung entwickelter Lösungen durch andere Kommunen.
Rosenheim: Umfassende Cloud-Migration
[21.01.2026] Wie eine sichere, wirtschaftliche und souveräne Cloud-Einführung im öffentlichen Sektor gelingen kann, zeigt sich in Rosenheim. Schrittweise wurden hier Verwaltung, Stadtgesellschaften und Schulen datenschutzkonform auf Microsoft 365 migriert. mehr...
Magdeburg: VR ergänzt analoge Beteiligung
[20.01.2026] In einem gemeinsam mit dem Fraunhofer IFF entwickelten Forschungsvorhaben will Magdeburg analoge Beteiligungsmethoden mit Virtual-Reality-Technologie verknüpfen. Für den ersten Einsatz ist ein durch 360-Grad-Panorama- und Bodenprojektionen virtuell begehbares Plangebiet erstellt worden. mehr...
AKDB: Cloudbasiertes Melderegister
[15.01.2026] Der Innovationswettbewerb „Register-as-a-Service“ von GovTech Platforms ist abgeschlossen. Ein von der AKDB geführtes Konsortium mit Komm.ONE, H&D, Scontain und mehreren Städten hat eine cloudbasierte Referenzlösung für das Melderegister entwickelt und erfolgreich in vier Kommunen erprobt. mehr...
Halle (Saale): Smarte Technik statt Parksuchverkehr
[05.01.2026] Ein beliebtes Erlebnisbad sorgte in Halle (Saale) bislang für unnötigen Verkehr in einem Wohngebiet. Der Grund: Es werden Parkplätze gesucht. Die Echtzeitanzeige der Parkhausbelegung am Erlebnisbad plus Hinweis auf alternative Parkmöglichkeiten sollen dem nun ein Ende bereiten. mehr...
GovTech Deutschland: Ergebnisse des RaaS-Projekts
[22.12.2025] GovTech Deutschland hat das Projekt Register-as-a-Service (RaaS) abgeschlossen. Die Ergebnisse – eine vollständige Referenzarchitektur, funktionale technische Implementierungen und ein begleitendes Rechtsgutachten für moderne Cloud-Register – stehen Open Source über die Plattform openCode zur Verfügung. mehr...
Digitale Barrierefreiheit: Inklusive Transformation
[19.12.2025] In einer neuen Modulserie des eGov-Campus steht das Thema digitale Barrierefreiheit im Vordergrund. Der Kurs sensibilisiert die Teilnehmenden für dieses Thema, informiert über rechtliche Grundlagen und vermittelt praktische Umsetzungshilfen. mehr...
Reutlingen: Ausbau digitaler Dienstleistungen
[12.12.2025] In Reutlingen wächst das Angebot digitaler Verwaltungsdienstleistungen. Dazu zählen vollständig digitale Prozesse ebenso wie die flächendeckend angebotenen Fototerminals für Passbilder. Auch können Fundsachen online aufgerufen werden. Weitere Onlineservices bietet außerdem das Standesamt an. mehr...
München: Feedback zum Deutschland-Stack
[11.12.2025] Mit ihren Anmerkungen zum Deutschland-Stack will die bayerische Landeshauptstadt München dazu beitragen, die digitale Transformation der Verwaltung voranzutreiben. Unter anderem regt die Stadt an, die kommunalen Bedürfnisse sowie die Dresdner Forderungen zur digitalen Verwaltung mehr zu berücksichtigen. mehr...
BW-Empfangsclient: Anträge ohne Fachsoftware empfangen
[10.12.2025] Mit dem BW-Empfangsclient können Kommunal- und Landesbehörden in Baden-Württemberg jetzt auch solche digitalen Verwaltungsleistungen anbieten, für die sie bislang keine Fachsoftware nutzen. Die Behörden können sich kostenfrei selbst registrieren, die Lösung ist sofort einsetzbar. mehr...
Fulda: Enge Kooperation mit ekom21
[09.12.2025] Eine engere Kooperation haben die Stadt Fulda und ekom21 vereinbart. Dabei hat die Kommune auch Fachverfahren ins Rechenzentrum des kommunalen IT-Dienstleisters überführt. mehr...
Wien: Open Source stärkt Europas Unabhängigkeit
[08.12.2025] Die Europäische Kommission würdigt die Open-Source-Strategie Wiens. In einem neuen Bericht wird die Stadt als führend beschrieben. Wien setzt auf offene Software, um digital unabhängig und sicher zu arbeiten. mehr...
Onlineformulare: Gegenseitig unterstützen
[01.12.2025] Onlineformulare sind heute unverzichtbar – und EfA-Leistungen decken längst nicht alles ab. Mit No-Code-Formularen und im interkommunalen Austausch können Städte und Gemeinden hier flexibel und kostenbewusst agieren. mehr...
Deutsche Verwaltungscloud: Digitale Antragsbearbeitung made in Hessen
[26.11.2025] Mit HessenDANTE bietet die HZD eine innovative Plattform, mit der sich die Antragstellung für unterschiedlichste Verwaltungsleistungen komplett digital und OZG-konform abbilden lässt. Das Paket ist nun auch über die Deutsche Verwaltungscloud zu beziehen. mehr...
Axians Infoma: Innovationspreis 2025 verliehen
[24.11.2025] Mit Künstlicher Intelligenz (KI) konnte die Stadtverwaltung Bad Dürkheim ihren Eingangsrechnungsprozess automatisieren. Für diese Maßnahme ist sie mit dem Axians Infoma Innovationspreis 2025 ausgezeichnet worden. Zu den Finalisten zählen außerdem das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis und die Stadt Fürth. mehr...
Baden-Württemberg: Virtuelles Amt für Kommunen
[05.11.2025] In Baden-Württemberg fördert das Digitalministerium gemeinsam mit der Digitalakademie@bw die Kommunen beim Ausbau des Virtuellen Amts mit insgesamt 400.000 Euro. Bewerbungen können noch bis zum 15. Dezember eingereicht werden. Interessierte Kommunen wenden sich direkt an IT-Dienstleister Komm.ONE. mehr...