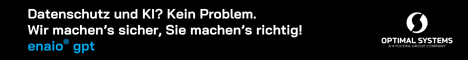Interkommunales NetzwerkMobiler in der Ortenau

Sarah Berberich begleitet als Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal das Mobilitätsnetzwerk Ortenau.
(Bildquelle: endura kommunal)
Frau Berberich, im Mobilitätsnetzwerk Ortenau treiben 14 Kommunen Alternativen zum Individualverkehr voran. Endura kommunal leitet heute die Geschäftsstelle des Netzwerks. Wie kam es zu dessen Gründung und welche Ziele wurden damals definiert?
Nahezu alle Prognosen gehen von einem Verkehrswachstum in den kommenden Jahren aus. Das gilt auch für die Ortenau. Nimmt der motorisierte Individualverkehr überhand, kann das die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verschlechtern. Um dies zu verhindern, muss der öffentliche Personennahverkehr attraktiver werden. Hierzu können multimodale Verkehrsangebote beitragen, die den nicht immer alltagstauglichen ÖPNV im ländlichen Raum ergänzen. Beispielsweise können per Carsharing oder Mietrad die so genannte erste und letzte Meile zu Verkehrsknotenpunkten komfortabel zurückgelegt werden. Um solche Potenziale zu erschließen, haben im Jahr 2019 Appenweier, Friesenheim, Gengenbach, Kehl, Lahr, Neuried, Offenburg, Rheinau, Schutterwald und Willstätt gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen endura kommunal das Mobilitätsnetzwerk Ortenau gegründet. Gemeinsam wollen sie den ländlichen Raum über nachhaltige Alternativen zum Autoverkehr mit den Städten verknüpfen. Im Jahr 2022 schlossen sich auch Achern, Oberkirch, Schwanau und Seelbach diesem bundesweit ersten Mobilitätsnetzwerk an.
Wie zahlt sich das Netzwerk für die Kommunen aus?
Das Mobilitätsnetzwerk sieht sich als eine Solidargemeinschaft mit den großen Kreisstädten als Zugpferde. Diese profitieren von der Förderung eines nachhaltigen Verkehrsangebots in den Herkunftskommunen vieler Einpendler, die kleineren und mittleren Gemeinden wiederum von dem im Netzwerk erarbeiteten Wissen. Allein hätten sie häufig nicht die personellen Kapazitäten und das Know-how, um solch große Schritte zu gehen. Auch kommen sie im Netzwerk besser an Fördergelder, während ihr einzelner Antrag oft unterhalb der Bagatellgrenze liegen würde. Alle Kommunen sparen zudem Kosten, etwa durch gemeinsame Ausschreibungen.
Was macht das Mobilitätsnetzwerk Ortenau so einzigartig?
Das Mobilitätsnetzwerk ist von unten, aus den Kommunen heraus, entstanden, weil diese klimafreundliche Mobilitätsangebote schaffen wollten. Aus diesem Grund gibt es auch eine große Identifikation mit dem Thema Mobilität vor Ort und der Mitgliedschaft der einzelnen Kommunen im Netzwerk. Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau ist meines Wissens das erste Netzwerk dieser Art in Deutschland.
Welche Hürden galt es in den ersten Jahren zu überwinden?
Zugegeben: Der Anfang war schwer. Bis alles in die Gänge kam, dauerte es. Zuerst haben wir in regelmäßigen Netzwerktreffen einen engen Austausch gestartet und Themen identifiziert, die gemeinsam bearbeitet werden sollen. Bei den Treffen lernen wir voneinander und besprechen nächste Umsetzungsschritte. Wichtig ist auch, die Interessen zwischen großen und kleinen Kommunen abzugleichen. Mittlerweile geht es gut voran und das Netzwerk kann viele Ergebnisse vorweisen.
Was sind aktuelle Schwerpunkte?
Im Fokus stehen derzeit Mobilitätsstationen. Sie werden etwa am Bahnhof, im Ortskern oder beim Campingplatz errichtet und ermöglichen den nahtlosen Wechsel zwischen Zug, Bus, Carsharing-Auto, Mietfahrrad, -pedelec und Lasten-Pedelec. Die Mobilitätsstationen sind einheitlich gestaltet, alle Angebote haben die gleichen Tarife. Das erleichtert die Nutzung über die Gemarkungsgrenzen hinweg. Mietfahrräder und -pedelecs können sogar in Kommune A ausgeliehen und in Kommune B abgestellt werden.
„Das Mobilitätsnetzwerk sieht sich als eine Solidargemeinschaft mit den großen Kreisstädten als Zugpferde.“
Wie finanziert sich das Netzwerk?
Jede Kommune zahlt einen Jahresbeitrag, der sich an der Einwohnerzahl bemisst. Kleine Kommunen zahlen 5.000 Euro pro Jahr, große Kommunen 10.000 Euro. Ein wichtiger Finanzierungstopf ist die Bundesförderung: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt die Netzwerkarbeit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative mit rund 60 Prozent. Über drei Jahre bekamen wir eine Förderung von jährlich rund 180.000 Euro, sie endet im September 2025. Damit werden das Netzwerkmanagement durch die Geschäftsstelle finanziert, die Fördermittelberatung, die rechtliche und fachliche Beratung der Bauämter, die Sachkosten für die Netzwerktreffen und die Vernetzungsplattform. Über den Innovationsfonds des Energieversorgers Badenova bekommen wir künftig noch einmal zwei Jahre lang insgesamt 350.000 Euro, ein Teil davon wird für den operativen Weiterbetrieb des Netzwerks genutzt. Die anschließende Grundfinanzierung ist noch nicht in trockenen Tüchern.
Die neue App Ortenau Mobil soll den Umstieg zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln erleichtern. Welche Funktionen bietet sie genau?
Mit der landkreisweiten App können die Mobilitätsstationen des Netzwerks genutzt werden. Das Mobilitätsnetzwerk hat die App-Entwicklung angestoßen, der Ortenaukreis hat sie in die Umsetzung gebracht. Mit Ortenau Mobil können Fahrgäste die schnellste und günstigste Verbindung für eine Strecke mittels Bus, Bahn, Mietrad, Pedelec oder Carsharing ermitteln.
Welche Herausforderungen gab es bei der technischen Entwicklung der App?
Die App basiert auf jenem System, das auch der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) nutzt. Er grenzt im Norden an den TGO-Tarifverbund Ortenau, was eine Anbindung möglich und attraktiv macht. Wir haben uns durch die Nutzung des Systems auch Synergien und somit Einsparungen erhofft. Diese sind aber nicht alle eingetreten. Ein Defizit ist, dass die Bezahlung der Sharing-Angebote über die App bislang nicht möglich ist.
Welche Pläne gibt es für das Mobilitätsnetzwerk Ortenau bis 2030?
Bis 2030 sind rund 150 Mobilitätsstationen vorgesehen. Allein auf Offenburger Gemarkung sind 30 Stationen geplant, derzeit gibt es 25 Anlaufstellen für die Nutzerinnen und Nutzer. Die Buchung und Bezahlung aller Angebote sollen künftig über die App erfolgen. Eine Vision ist, dass das Mobilitätsnetzwerk in den kommenden Jahren als Struktur für künftige Mobilitätsentwicklungen dient – etwa für die On-Demand-Mobilität. Auch Radwege von Ort zu Ort sind vorgesehen. Für unsere Aktivitäten haben wir 2023 eine Auszeichnung des Best-Practice-Projektpools Stadtimpulse erhalten. Die Begründung: Das Mobilitätsnetzwerk sei ein Vorreiter beim Aufbau eines nachhaltigen Mobilitätsangebots im ländlichen Raum und ein Vorbild für andere Regionen. Darauf sind wir schon ein wenig stolz. Zwar haben wir noch viel zu tun. Wir sind aber schon ein gutes Stück vorangekommen, Alternativen zum eigenen Auto anzubieten.
Hannover: Mit KI zur nachhaltigen Grünpflege
[16.07.2025] Ein innovatives Projekt zur nachhaltigen Stadtbegrünung mit Künstlicher Intelligenz ist jetzt in Hannover gestartet. Im Rahmen von BlueGreenCity-KI sollen unter anderem Methoden zur intelligenten Speicherplanung und Bewässerung entwickelt sowie automatisierte Prognosen für den individuellen Bewässerungsbedarf erstellt werden. mehr...
Kempten: Digitale Verkehrsanalyse
[15.07.2025] Kempten setzt in der Verkehrsmessung intelligente Kamerasysteme ein. Sie erfassen anonymisiert die Anzahl der Fahrzeuge im Stadtkern, in welche Richtung sie fahren und wie lange sie sich in bestimmten Bereichen aufhalten. Die Daten fließen direkt in die städtische Mobilitätsstrategie ein. mehr...
Kaiserslautern: Altstadtfest mit IT-Sicherheitskonzept
[11.07.2025] Im Sicherheitskonzept rund um das Kaiserslauterer Altstadtfest hat Smart-City-Technologie eine wichtige Rolle gespielt. Sie gewährleistete eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung für Einsatzkräfte und Rettungsdienst und sorgte für ein stets aktuelles Lagebild im Einsatzzentrum. mehr...
Mönchengladbach: Smart City der Bürgerinnen und Bürger
[11.07.2025] Die Smart City Mönchengladbach soll nicht zuletzt von Bürgerideen und -anwendungen getragen werden. Dazu zählen beispielsweise gemeinsam entwickelte Lösungen, mit denen Interessierte direkt oder indirekt den öffentlichen Raum mitgestalten können. mehr...
Halle (Saale): Wassersensibel dank Sensorik
[10.07.2025] Die Stadt Halle (Saale) testet neue Wege einer klimaangepassten Stadtentwicklung mittels Smart-City-Technologien. Als Pilotgebiet dient das Lutherviertel. mehr...
Bad Homburg: Ausbau der Smart-City-Aktivitäten
[09.07.2025] Bad Homburg, Friedrichsdorf und Wehrheim werden bei der Umsetzung ihrer Smart-City-Aktivitäten vom Land Hessen finanziell unterstützt. Bei einem Besuch von Digitalministerin Kristina Sinemus wurden nun die Fortschritte im Projekt „Digital und smart den Limes überwinden“ sowie die Pläne für das Vorhaben „Digitale Stadt und Infrastruktur“ präsentiert. mehr...
Wiesbaden: Digitaler Zwilling für die Stadtentwicklung
[08.07.2025] Wiesbaden bekommt einen Digitalen Zwilling. Er integriert beispielsweise Luftbilder, Geodaten, Planungs- und Standortinformationen und dient damit als Instrument zur datenbasierten und transparenten Stadtentwicklung. Sukzessive soll das virtuelle Abbild Wiesbadens weiterentwickelt werden. mehr...
Dortmund: Sensoren erfassen Brückenzustand
[08.07.2025] Kontinuierlich überwacht Dortmund nun den Zustand der neuen Remberg-Brücke. Das Bauwerk wurde mit insgesamt 14 Sensoren ausgestattet, die Temperatur, Feuchtigkeit, Vibrationen, Materialspannungen und kleinste Risse erfassen. Die Daten fließen in Echtzeit an das Tiefbauamt. mehr...
Dortmund: Stadtweites Klima-Messnetz gestartet
[04.07.2025] Wie heiß wird Dortmund? Um die Hitzebelastung in der Stadt messen und grafisch darstellen zu können, ist in der Ruhrmetropole jetzt ein stadtweites Klima-Messnetz inklusive interaktivem Dashboard gestartet. mehr...
Arnsberg: Datenplattform liefert Echtzeitdaten
[02.07.2025] Von Wetter- und Klimadaten über Energieverbräuche bis hin zu Pegelständen zeigt eine neue Plattform Echtzeitdaten für die Stadt Arnsberg an. Die Lösung soll sukzessive erweitert werden. Technisch basiert sie auf einer offenen, im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities entwickelten Anwendung. mehr...
Innovation trifft Praxis: Digitale Teilhabe auf dem Land
[24.06.2025] Mit praxisnahen Vorträgen, Good Practices, Technik-Demonstrationen und Diskussionsrunden soll am 25. Juni in Schimberg ersichtlich werden, wie die Digitalisierung abseits der großen Städte gelingt. Die Veranstaltung kann kostenlos und online im Livestream oder vor Ort besucht werden. mehr...
Bad Nauheim: Hessens dritter Smart Region Hub
[24.06.2025] Ende Juni eröffnet mit Digital.im.Puls der dritte Smart Region Hub in Hessen. Mit smarten Technologien macht er in Bad Nauheim digitale Anwendungsbeispiele im Stadtleben ersichtlich und soll als Ort der Ideen, des Austauschs und der Zusammenarbeit fungieren. mehr...
Digitales Duisburg: Ergebnisse der Bürgerbeteiligung
[20.06.2025] Duisburg arbeitet derzeit an der Version 2.0 des Smart-City-Masterplans der Stadt. Bis Ende Mai fand dazu eine hybride Bürgerbeteiligung statt, für die nun erste Ergebnisse vorliegen. Positiv bewertet wurden beispielsweise die DuisburgApp und der Mängelmelder. mehr...
Bürstadt / Lampertheim: Smart City interkommunal umsetzen
[20.06.2025] Den Weg zur Smart City gehen die Städte Bürstadt und Lampertheim gemeinsam. Das Projekt umfasst unter anderem Lösungen zur smarten, bedarfsgerechten Bewässerung, zur Verkehrszählung oder zur Waldbranddetektion. mehr...
Mönchengladbach: Neues Stadtlabor startet
[17.06.2025] Mönchengladbach eröffnet jetzt das stadtlabor.mg, ein Citizen Lab, das als zentraler Ort für digitale Bildung, das gemeinsame Forschen und die digitale Teilhabe dienen soll. In Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern sollen hier digitale Lösungen für die Stadt entwickelt und getestet werden. mehr...