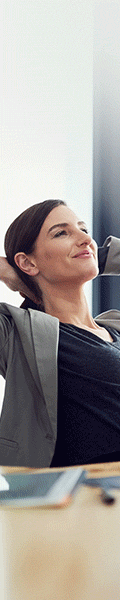Schul-IT:
Föderale Befindlichkeiten
[29.6.2023] Bei der Digitalisierung der Schulen wiederholt sich, was seit vielen Jahren in der Verwaltung misslingt: Anstatt gemeinsam bei einer sicheren und soliden IT-Infrastruktur zu kooperieren, betreiben die Länder eine Vielzahl teurer Einzellösungen.
 Der Föderalismus, der auch das Bildungssystem prägt, erweist sich mitunter als Hemmschuh bei der Digitalisierung der Schulen. Effiziente Digitalisierung beruht auf technischen Standards, interoperablen Infrastrukturen und funktionalen Online-Anwendungen, die möglichst überall ähnlich zu bedienen sind. Erst dann können Skaleneffekte generiert, Wirtschaftlichkeit erzielt und gute Usability erreicht werden – und damit Akzeptanz. Doch wie bei der Verwaltungsdigitalisierung fällt es offenbar auch bei der Digitalisierung der Schulen schwer, sich auf gemeinsame Standards zu einigen und länderübergreifend zu agieren.
Der Föderalismus, der auch das Bildungssystem prägt, erweist sich mitunter als Hemmschuh bei der Digitalisierung der Schulen. Effiziente Digitalisierung beruht auf technischen Standards, interoperablen Infrastrukturen und funktionalen Online-Anwendungen, die möglichst überall ähnlich zu bedienen sind. Erst dann können Skaleneffekte generiert, Wirtschaftlichkeit erzielt und gute Usability erreicht werden – und damit Akzeptanz. Doch wie bei der Verwaltungsdigitalisierung fällt es offenbar auch bei der Digitalisierung der Schulen schwer, sich auf gemeinsame Standards zu einigen und länderübergreifend zu agieren.Beim Blick auf den digitalen Status quo an Schulen erscheint das fragwürdig: Seit Mai 2019 stehen den Lehranstalten große finanzielle Mittel durch den DigitalPakt Schule zur Verfügung, insgesamt mehr als sechs Milliarden Euro. Einer Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion beim Bundesbildungsministerium zufolge fließen die Mittel jedoch nach wie vor sehr langsam ab. Vor allem hakt es in den Bereichen IT-Administration, Verwaltung der Technik und technische Betreuung. Ein im Nachhinein eingerichteter Sonderfördertopf für IT-Administration wird nur wenig nachgefragt und entsprechende Anträge sehr langsam bewilligt.
Fehlende Expertise an Schulen
Das liegt nicht zuletzt an fehlender Expertise an den Schulen. Dort besteht das IT-Management oftmals immer noch aus einer dafür abbestellten Lehrkraft, die sich um die Schul-IT kümmert und im Gegenzug Freistunden erhält. Große Lehranstalten mit mehr als 1.000 Schülerinnen und Schülern können sich vielleicht professionellen externen Support leisten. Einen eigenen IT-Administrator anzustellen, lohnt sich aber allenfalls für Schulverwaltungen. Dass in deutschen Schulen überhaupt noch Server-Stationen im Keller stehen und von Systemadministratoren betreut werden, erscheint ohnehin antiquiert und entspricht nicht dem Stand der Technik. State of the Art ist die Cloud-Technologie. Schulen benötigen, um in die Cloud zu gehen, im Grunde nur noch eine schnelle Internet-Anbindung.
Ein Beispiel dafür ist die Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts (HPI). 2016 als Open-Source-Projekt gestartet, nahmen bereits im Folgejahr 27 Pilotschulen an der Cloud-Infrastruktur teil. Ziel war es, eine sichere IT-Umgebung für Schulen zu entwickeln, die es Schülerinnen und Schülern, aber auch Lehrkräften erlaubt, mit unterschiedlichen Endgeräten wie Rechnern, Tablets und Smartphones flexibel darauf zugreifen und kollaborativ zusammenarbeiten zu können. Aufwendiges IT-Management entfällt, da alle Funktionen und Anwendungen einer Schul-Cloud per Webbrowser zugänglich sind, der ja auf allen Endgeräten vorhanden ist. Zusätzlicher Vorteil: Eine professionell betriebene Cloud-Infrastruktur ist deutlich sicherer als unregelmäßig gewartete Kellertechnik.
Teilnahme an HPI-Cloud
Zunächst nahmen Schulen aus dem nationalen Exzellenz-Schulnetzwerk MINT-EC an der HPI-Cloud teil, 2018 schloss Niedersachsen einen Ländervertrag ab, im Folgejahr gingen Brandenburg und Thüringen jeweils länderspezifische Kooperationen mit dem HPI ein. 2020 schloss sich auch das Zentralamt für Auslandsschulwesen an. Als im selben Jahr die Corona-Pandemie losbrach und die desolate digitale Situation an vielen Schulen offenkundig wurde, konnten binnen eines halben Jahres bundesweit 3.500 Schulen in die Schul-Cloud des HPI eingebunden werden. 2021 ging sie an den öffentlichen IT-Dienstleister Dataport über. Momentan sind 4.100 Schulen registriert, und von den 2,1 Millionen Nutzerinnen und Nutzern sind 1,9 Millionen Schüler.
Die Funktionalitäten der Schul-Cloud umfassen Anwendungen für Kommunikation und Kollaboration, das heißt, Schülerinnen und Schüler können auf der Plattform untereinander und mit den Lehrkräften kommunizieren oder auch Videokonferenzen abhalten. Ein Lern-Store stellt Bildungsmedien zur Verfügung, es gibt einen News-Bereich, eine Aufgabenverwaltung, Stundenplan und Kalender, eine Dateienablage sowie einen eigenen Messenger-Dienst. „Technisch wird die Schul-Cloud von Grund auf neu entwickelt“, berichtet Matthias Luderich, Abteilungsleiter Lösungen Bildungswesen bei Dataport, „wobei auch neue Funktionen entstehen wie die Integration von Nextcloud als Datei-Sharing und ein neues Management von Identitäten mittels Keycloak.“ Luderich hebt auch die strengen Anforderungen an Datenschutz, IT-Sicherheit und Barrierefreiheit hervor.
Förderung durch das BMBF
Von Anfang an wurde die Schul-Cloud des HPI vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als Pilotprojekt gefördert. Zunächst flossen sieben Millionen Euro für die technische Entwicklung und Umsetzung. 2020 stellte das BMBF nochmals zwölf Millionen Euro zur schnellen Unterstützung der Schulen in der Coronakrise zur Verfügung. Hierüber regte sich viel Unmut. Kommerzielle Anbieter ärgerten sich über eine Wettbewerbsverzerrung, politische Parteien wie Grüne und Liberale monierten die Vergabepraxis. Und als aus dem Pilotprojekt schließlich ein Marktteilnehmer wurde, wandten sich sieben Privatanbieter per Brief an das BMBF und beklagten eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips. Die Anbieter waren an Schul-IT-Systemen in anderen Bundesländern beteiligt, und aus diesen kam das altbekannte Argument, der Bund möge sich nicht in die Bildungspolitik der Länder einmischen.
Dort werden ganz unterschiedliche Bildungsplattformen betrieben: von Moodle, SESAM, DiLer und ella@bw in Baden-Württemberg über learn:line, Edmond, Biparcours und Logineo in Nordrhein-Westfalen bis hin zu Schulbox RLP, MNS+, moodle@rlp, Emogea, Etherpad und Schulcampus.RLP in Rheinland-Pfalz. Nur Berlin, Bayern und Thüringen begnügen sich mit einer einheitlichen landesweiten Lösung. Von einem völligen Wildwuchs von Systemen zu sprechen, erscheint angesichts der vom jeweiligen Kultusministerium genehmigten Vielfalt an technischen Systemen – insgesamt 46 bundesweit – nicht übertrieben. Das ist vielleicht aus didaktischer Perspektive nicht zu beanstanden, solange der digitale Unterricht funktioniert und die Bildungsziele erreicht werden, aber doch zumindest volkswirtschaftlich wenig effizient.
Dezentral ist nicht besser
Der ehemalige HPI-Chef Christoph Meinel zeigte sich unzufrieden mit dem gegenwärtigen Kurs in der Schulpolitik. In einem Gespräch mit dem Berliner Tagesspiegel sagte er: „Es ist ein grundsätzliches Missverständnis, dass es besser ist, wenn in Deutschland alles dezentral organisiert ist.“ Eine digitale Infrastruktur könne nur im großen Maßstab effizient und sicher betrieben werden, und nur der Bund könne Skaleneffekte generieren, weil er die notwendigen Ressourcen habe. Vonseiten Dataport heißt es: „Wir sehen im Bereich der Schul-IT einen Bedarf für eine verstärkte föderale Zusammenarbeit. Beispiele wie der IT-Planungsrat und die FITKO, aber auch govdigital zeigen, dass dies im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung sehr hilfreich ist. Für die Schul-IT gibt es hier noch Entwicklungsmöglichkeiten.“
Helmut Merschmann
https://dbildungscloud.de
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juni 2023 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
Stichwörter: Schul-IT, Föderalismus, Schuldigitalisierung, HPI-Cloud
Bildquelle: sibstock/stock.adobe.com
Anzeige
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Schul-IT
Braunschweig: Interaktive Tafeln für jedes Klassenzimmer
[27.5.2024] Mit der vierten Fortschreibung des Medienentwicklungsplans setzt die Stadt Braunschweig den Ausbau der digitalen Lernumgebungen fort. Im Fokus steht unter anderem die Ausstattung aller Klassen- und Fachräume mit interaktiven Tafeln bis zum Jahr 2029. mehr...
[27.5.2024] Mit der vierten Fortschreibung des Medienentwicklungsplans setzt die Stadt Braunschweig den Ausbau der digitalen Lernumgebungen fort. Im Fokus steht unter anderem die Ausstattung aller Klassen- und Fachräume mit interaktiven Tafeln bis zum Jahr 2029. mehr...
Herne: Gut aufgestellt
Bericht
[23.5.2024] Trotz knapper Kassen macht die Stadt Herne Tempo bei der Digitalisierung ihrer Schulen. Rund 16.000 Endgeräte werden mit dem Mobile Device Management von Anbieter AixConcept verwaltet und so allen Schülern das Lernen mit einem iPad oder Laptop ermöglicht. mehr...
[23.5.2024] Trotz knapper Kassen macht die Stadt Herne Tempo bei der Digitalisierung ihrer Schulen. Rund 16.000 Endgeräte werden mit dem Mobile Device Management von Anbieter AixConcept verwaltet und so allen Schülern das Lernen mit einem iPad oder Laptop ermöglicht. mehr...
Schul-IT: Digitaler durch Corona
Interview
[16.5.2024] Der nordrhein-westfälische IT-Dienstleister regio iT begleitet aktuell rund 290 Schulen bei der Digitalisierung. Steffen Koch, Leiter der Business Unit „Digitale Bildung“, berichtet, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die IT in den Schulen hatte. mehr...
[16.5.2024] Der nordrhein-westfälische IT-Dienstleister regio iT begleitet aktuell rund 290 Schulen bei der Digitalisierung. Steffen Koch, Leiter der Business Unit „Digitale Bildung“, berichtet, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die IT in den Schulen hatte. mehr...
Düsseldorf: Digitalisierungsoffensive an Schulen
[13.5.2024] Bis Ende dieses Jahres sollen alle städtischen Schulen in Düsseldorf mit digitalen Tafeln, einem schnellen Internet-Anschluss und mobilen Endgeräten für den Unterricht ausgestattet sein. mehr...
[13.5.2024] Bis Ende dieses Jahres sollen alle städtischen Schulen in Düsseldorf mit digitalen Tafeln, einem schnellen Internet-Anschluss und mobilen Endgeräten für den Unterricht ausgestattet sein. mehr...
Bitkom: Ohne Digitalpakt 2.0 geht es nicht
[6.5.2024] Mit dem DigitalPakt Schule hat der Bund seit 2019 mehr als fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen bereitgestellt. Mitte Mai 2024 läuft das Programm aus. Für die Nachfolgevereinbarung, den Digitalpakt 2.0, gibt es einen ersten Entwurf. Der Bitkom findet diesen zu unkonkret und fordert kooperatives Handeln von Bund und Ländern. mehr...
[6.5.2024] Mit dem DigitalPakt Schule hat der Bund seit 2019 mehr als fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen bereitgestellt. Mitte Mai 2024 läuft das Programm aus. Für die Nachfolgevereinbarung, den Digitalpakt 2.0, gibt es einen ersten Entwurf. Der Bitkom findet diesen zu unkonkret und fordert kooperatives Handeln von Bund und Ländern. mehr...
Suchen...
Anzeige
Anzeige
Aboverwaltung
Aktuelle Meldungen