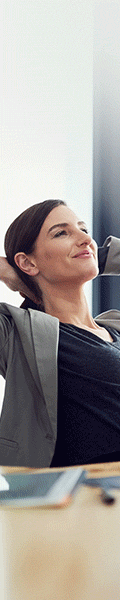Breitband:
Ausbau im Wettbewerb
[26.6.2019] Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2025 einen flächendeckenden Gigabitausbau realisieren. Dieses Vorhaben kann nur im Zusammenspiel mit den privaten Netzbetreibern und bei investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen gelingen.
 Laut dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung soll bis zum Jahr 2025 jeder Haushalt Zugang zu Gigabit-Konnektivität haben. Das ist sowohl im Hinblick auf die Breitband-Geschwindigkeit als auch auf die Flächendeckung eine große Herausforderung. Die anstehende Reform des Regulierungsrahmens für die Telekommunikationsbranche soll Anreize für den weiteren Ausbau bieten. Gleichzeitig will die Politik durch neue Förderprogramme den Ausbau bislang unterversorgter Gebiete sicherstellen.
Laut dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung soll bis zum Jahr 2025 jeder Haushalt Zugang zu Gigabit-Konnektivität haben. Das ist sowohl im Hinblick auf die Breitband-Geschwindigkeit als auch auf die Flächendeckung eine große Herausforderung. Die anstehende Reform des Regulierungsrahmens für die Telekommunikationsbranche soll Anreize für den weiteren Ausbau bieten. Gleichzeitig will die Politik durch neue Förderprogramme den Ausbau bislang unterversorgter Gebiete sicherstellen. Die im ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber vertretenen Netzbetreiber können heute bereits 12,3 Millionen Haushalten Gigabit-Konnektivität anbieten – sei es über neu aufgerüstete Glasfaserkabelnetze (Hybrid Fibre Coax, HFC) oder Glasfaser bis ins Haus (Fibre to the Home, FTTH/Fibre to the Building, FTTB). In den kommenden Jahren wird die Zahl der Haushalte, die Gigabitanschlüsse nutzen können, weiter steigen. Das liegt vor allem an der Aufrüstung der HFC-Netze mit dem Gigabitstandard DOCSIS 3.1. Perspektivisch werden in den HFC-Netzen noch deutlich höhere Bandbreiten verfügbar werden. Im Rahmen einer Vision 10G werden im nächsten Schritt Geschwindigkeiten möglich sein, die mit zehn Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) zehnmal so hoch sind wie das heutige Maximum.
Umlagefähigkeit nicht streichen
Für den Ausbau von Gigabitnetzen setzt Europa im Wesentlichen auf den Einsatz der privaten Netzbetreiber, die 90 Prozent der hierfür notwendigen finanziellen Mittel aufbringen sollen. Die Investitionen für die Weiterentwicklung existierender Netze zu Gigabitnetzen oder der Aufbau neuer Glasfasernetze sind erheblich: Die Netzbetreiber des ANGA-Verbands investieren Jahr für Jahr circa 20 Prozent ihrer Umsätze in den Ausbau ihrer Netze, um für die künftige Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsverbindungen gerüstet zu sein. Die Refinanzierbarkeit dieser Investitionen setzt ein stabiles und vorhersehbares regulatorisches Umfeld voraus.
Große Bedenken ruft daher ein Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, die mietrechtliche Umlagefähigkeit der Kosten des Betriebs von Inhouse-Infrastrukturen zu streichen. Das wäre breitbandpolitisch falsch; die Umlagefähigkeit hat dafür gesorgt, dass Verbraucher in den vergangenen zehn Jahren von mehr Leistung und Wahlmöglichkeiten durch einen echten Infrastrukturwettbewerb profitiert haben. Die Streichung wäre zudem rechtlich nicht erforderlich. Aus Sicht des ANGA-Verbands erfordern weder der von der EU im November 2018 beschlossene neue europäische Telekommunikationsrechtsrahmen (TK-Kodex) noch das Telekommunikationsgesetz (TKG) in seiner jetzigen Fassung eine Anpassung der Betriebskostenverordnung. Die in dem Vorschlag als Begründung herangezogenen Vorschriften über die maximale Laufzeit von Telekommunikationsverträgen finden auf den der Umlage zugrunde liegenden Sachverhalt keine Anwendung. Im Gegenteil: Eine Streichung der Umlagefähigkeit würde zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung von Inhouse-Netzen im Vergleich zu Gemeinschaftsantennenanlagen führen.
Zurückhaltung bei der Zugangsregulierung
Eine wichtige Rolle wird in diesem Jahr außerdem die Umsetzung neuer europäischer Vorgaben, also des TK-Kodex, spielen. Dieser macht eine Novellierung des Telekommunikationsgesetzes erforderlich. Zunächst ist zu begrüßen, dass die EU auch künftig auf den privatwirtschaftlichen Ausbau von Gigabitnetzen im Wettbewerb setzt. Denn der Infrastrukturwettbewerb ist seit Jahren wesentlicher Treiber für den Breitband-Ausbau. Den Infrastrukturwettbewerb fördern und bessere Konnektivität schaffen – das sind zwei gleichberechtigte Ziele, die sich nur gemeinsam verwirklichen lassen. Entscheidend für die künftige Ausgestaltung der Breitband-Politik und -Förderung ist die Definition von Netzen mit sehr hoher Kapazität. Das sind elektronische Kommunikationsnetze, die entweder komplett aus Glasfaserkomponenten bestehen oder eine ähnliche Netzleistung erbringen können. Der zweite Teil dieser Definition dürfte vor allem auf glasfaserbasierte Kabelnetze Anwendung finden, die mit dem Gigabit-Übertragungsstandard DOCSIS 3.1 aufgerüstet sind und damit Gigabit-Konnektivität bieten.
Grundsätzlich sollen laut TKG Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auch künftig einer Zugangsregulierung unterworfen sein. Darüber hinaus soll die Bundesnetzagentur die Möglichkeit erhalten, auch nicht marktmächtigen Unternehmen Zugangsverpflichtungen aufzuerlegen. Diese vom EU-Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit sollte in Deutschland aber möglichst zurückhaltend eingesetzt werden. Denn zum einen stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Regulierung aufgrund von beträchtlicher Marktmacht und einer generellen Zugangsregulierung. Zum anderen bleibt unklar, wie eine solche symmetrische Zugangsverpflichtung zum Ausbau schneller Netze beitragen und damit auf das Konnektivitätsziel einzahlen kann. Wahrscheinlicher ist, dass eine Verpflichtung aller Netzbetreiber unabhängig von ihrer Marktmacht investitionshemmend wirkt und damit den Ausbau schneller Netze eher behindert.
Förderung grauer Flecken
In ihrer Umsetzungsstrategie „Digitalisierung gestalten“ kündigt die Bundesregierung zudem ein Breitband-Förderprogramm für so genannte graue Flecken an. Demnach soll in Gebieten, in denen ein Betreiber bereits eine Breitband-Versorgung mit mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) anbietet, in absehbarer Zeit jedoch kein Netzbetreiber ein Gigabitnetz privatwirtschaftlich ausbauen wird, künftig staatliche Förderung möglich sein. Das soll den eigenwirtschaftlichen Ausbau schützen und sicherstellen, dass privatwirtschaftliche Investitionen nicht gefährdet werden. Der ANGA-Verband unterstützt dieses Ziel. Die Netze seiner Mitglieder können bereits heute oder zumindest in den kommenden Jahren Gigabitgeschwindigkeiten ermöglichen. Diese vorhandenen Gigabitnetze dürfen nicht mithilfe von Fördergeldern überbaut werden. Die privatwirtschaftlich ausbauenden Netzbetreiber müssen vielmehr sicher sein können, dass ihre Investitionen nicht entwertet werden. Die Vorschläge zur künftigen Förderung weisen in die richtige Richtung; bei der weiteren Ausarbeitung sind aber noch andere Aspekte zu berücksichtigen.
So ist bei der Abgrenzung der förderfähigen Gebiete die Gigabitfähigkeit bereits vorhandener Netze zu berücksichtigen und nicht die Existenz tatsächlicher Gigabitangebote. Ausschlaggebend für die Frage, ob Förderung in einem Gebiet notwendig ist, kann nur die technische Möglichkeit zum Angebot von Gigabitbandbreiten sein. Die tatsächliche Einführung von Gigabitprodukten sollte hingegen dem Markt überlassen bleiben. Gebiete, in denen ein vorhandenes Gigabitnetz Lücken aufweist, sollten zunächst von einer Förderung ausgeschlossen sein. So behalten Netzbetreiber die Möglichkeit, ihre Netze eigenwirtschaftlich zu erweitern und bestehende Versorgungslücken zu schließen.
Passende Rahmenbedingungen
In den kommenden Monaten wird sich entscheiden, in welchem Rahmen eigenwirtschaftliche Investitionen in den Breitband-Ausbau zum Gigabitziel der Bundesregierung beitragen können. Eine investitionsfreundliche Regulierung und eine Förderung, die private Investitionen nicht gefährdet, sind wesentliche Voraussetzungen dafür.
Dr. Andrea Huber ist Geschäftsführerin des ANGA Verbands Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V.
https://www.anga.de
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juni 2019 von Kommune21 im Schwerpunkt Breitband erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
Stichwörter: Breitband, ANGA
Bildquelle: ThomBal/Fotolia.com
Anzeige
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Breitband
Berlin: Markterkundung für den Gigabit-Ausbau
[24.5.2024] Die Gigabit-Förderung des Bundes ging im April in eine neue Runde. Mit Markterkundungsverfahren, sollen konkrete Förderbedarfe und -gebiete im Vorfeld erhoben werden. In Berlin startet jetzt das größte Markterkundungsverfahren in der Geschichte der Bundesförderung. mehr...
[24.5.2024] Die Gigabit-Förderung des Bundes ging im April in eine neue Runde. Mit Markterkundungsverfahren, sollen konkrete Förderbedarfe und -gebiete im Vorfeld erhoben werden. In Berlin startet jetzt das größte Markterkundungsverfahren in der Geschichte der Bundesförderung. mehr...
Landkreis Karlsruhe: Kooperationen statt Doppelausbau
[23.5.2024] Der Landkreis Karlsruhe hat einen Weg gefunden, der einen Doppelausbau der Glasfaserinfrastruktur vermeidet. Dabei werden geförderter Ausbau durch den Landkreis und eigenwirtschaftlicher Ausbau durch Telekommunikationsunternehmen kombiniert. Diese nutzen die bereits geschaffene Infrastruktur mit. mehr...
[23.5.2024] Der Landkreis Karlsruhe hat einen Weg gefunden, der einen Doppelausbau der Glasfaserinfrastruktur vermeidet. Dabei werden geförderter Ausbau durch den Landkreis und eigenwirtschaftlicher Ausbau durch Telekommunikationsunternehmen kombiniert. Diese nutzen die bereits geschaffene Infrastruktur mit. mehr...
Münster: Kostenlos surfen am Hafen
[23.5.2024] Am Stadthafen Münster kann jetzt kostenlos im Internet gesurft werden. Realisiert wurde das WLAN-Angebot von der Stadt Münster gemeinsam mit den Stadtwerken und der VR Bank Westfalen-Lippe. Die Testphase läuft zunächst ein Jahr. mehr...
[23.5.2024] Am Stadthafen Münster kann jetzt kostenlos im Internet gesurft werden. Realisiert wurde das WLAN-Angebot von der Stadt Münster gemeinsam mit den Stadtwerken und der VR Bank Westfalen-Lippe. Die Testphase läuft zunächst ein Jahr. mehr...
Glasfaserausbau: Allianz für Open Access
[15.5.2024] Um den Glasfaserausbau zu beschleunigen, haben die vier Kommunikationsinfrastruktur-Unternehmen Deutsche GigaNetz, DNS:NET, Infrafibre Germany und Eurofiber Netz eine Absichtserklärung für eine neue Allianz unterzeichnet. Vom Open-Access-Modell können sowohl der deutschlandweite Infrastrukturausbau als auch die Verbraucher profitieren. mehr...
[15.5.2024] Um den Glasfaserausbau zu beschleunigen, haben die vier Kommunikationsinfrastruktur-Unternehmen Deutsche GigaNetz, DNS:NET, Infrafibre Germany und Eurofiber Netz eine Absichtserklärung für eine neue Allianz unterzeichnet. Vom Open-Access-Modell können sowohl der deutschlandweite Infrastrukturausbau als auch die Verbraucher profitieren. mehr...
Frankfurt am Main: Public WLAN gestartet
[10.5.2024] Das Frankfurter Public WLAN ist jetzt gestartet. Die Accesspoints sind an Hauptwache und Konstablerwache sowie auf dem Römerberg installiert. Ein weiterer Zugang am Paulsplatz soll folgen. mehr...
[10.5.2024] Das Frankfurter Public WLAN ist jetzt gestartet. Die Accesspoints sind an Hauptwache und Konstablerwache sowie auf dem Römerberg installiert. Ein weiterer Zugang am Paulsplatz soll folgen. mehr...
Suchen...
Anzeige
Anzeige
Aboverwaltung
Aktuelle Meldungen