Open Source:
An Bedeutung gewonnen
[12.3.2014] Die öffentliche Verwaltung bemüht sich seit einiger Zeit verstärkt um mehr Transparenz und digitale Offenheit. Damit einhergehend hat auch das Thema Open Source einen Bedeutungswandel erfahren.
 Vor gut zehn Jahren sorgte die Stadt München mit der Ankündigung, Windows auch am Desktop durch Linux ersetzen zu wollen, für weltweites Aufsehen. Zahlreiche Kommunalverwaltungen teilten mit, der bayerischen Landeshauptstadt auf diesem Weg folgen zu wollen. In vielen Fällen, wie zum Beispiel in Berlin, blieb es jedoch bei der Ankündigung. In anderen Fällen, etwa in Wien, wurde ein wenig mit Linux experimentiert, jedoch ohne flächendeckende Umstellungen vorzunehmen. In München ist Linux seit dem vergangenen Jahr nun im Regelbetrieb im Einsatz. Zehn Jahre nach dem Umstiegsbeschluss ist es deshalb an der Zeit, einen zweiten Blick auf die versprochenen Vor- und befürchteten Nachteile von Open Source im öffentlichen Sektor zu werfen: Welche Hoffnungen wurden enttäuscht? Welche neuen Potenziale wurden entdeckt? Worin liegt der Wert von Open Source und wie hat sich dieser im Zeitverlauf gewandelt?
Vor gut zehn Jahren sorgte die Stadt München mit der Ankündigung, Windows auch am Desktop durch Linux ersetzen zu wollen, für weltweites Aufsehen. Zahlreiche Kommunalverwaltungen teilten mit, der bayerischen Landeshauptstadt auf diesem Weg folgen zu wollen. In vielen Fällen, wie zum Beispiel in Berlin, blieb es jedoch bei der Ankündigung. In anderen Fällen, etwa in Wien, wurde ein wenig mit Linux experimentiert, jedoch ohne flächendeckende Umstellungen vorzunehmen. In München ist Linux seit dem vergangenen Jahr nun im Regelbetrieb im Einsatz. Zehn Jahre nach dem Umstiegsbeschluss ist es deshalb an der Zeit, einen zweiten Blick auf die versprochenen Vor- und befürchteten Nachteile von Open Source im öffentlichen Sektor zu werfen: Welche Hoffnungen wurden enttäuscht? Welche neuen Potenziale wurden entdeckt? Worin liegt der Wert von Open Source und wie hat sich dieser im Zeitverlauf gewandelt? Kurzfristige Effizienzargumente
In technischer Hinsicht galt vor zehn Jahren ebenso wie heute: Mit Open Source Software lässt sich eine vergleichbare Qualität wie mit proprietären Standardlösungen realisieren – vielleicht etwas weniger komfortabel, dafür aber flexibler und sicherer. Damals wie heute dominieren vor allem betriebs- und volkswirtschaftliche sowie politische Argumente die Diskussionen rund um einen verstärkten Einsatz von Open-Source-Lösungen.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht werden beträchtliche Wechselkosten den erhofften Einsparungen aufgrund von Lizenzkostenfreiheit und größerer Anbietervielfalt gegenübergestellt. Auch für die Frage von Open Source gilt dabei das Primat kurzfristiger Effizienzargumente, die unter dem Banner von New Public Management, Doppik oder Rationalisierung in der öffentlichen Verwaltung Einzug gehalten haben. Nur Lösungen, die Kostensenkungen versprachen, wurden überhaupt in Betracht gezogen. Argumentiert wird aber nicht nur mit Anschaffungs- und Wartungskosten, sondern mit den so genannten Total Cost of Ownership (TCO) – also einem breiten Kostenverständnis. Tatsächlich muss gerade bei seriöseren TCO-Kalkulationen eine ganze Reihe spezifischer Annahmen getroffen werden, die sich im Nachhinein fast immer in Teilen als naiv oder fehlgeleitet herausstellen – im Guten wie im Schlechten, wohlgemerkt.
Gerade weil bei TCO-Kalkulationen auch strategische Aspekte und weiche Faktoren einberechnet werden, für die es keine klaren Preise gibt, bedeutete TCO am Ende häufig, sich für die Lösung zu entscheiden, die man für die vernünftigste hält. Leider lässt sich häufig nicht einmal im Nachhinein mit Sicherheit sagen, welche Entscheidung aus betriebswirtschaftlicher Sicht die richtige gewesen wäre. Oftmals ändern sich im Projektverlauf Ziele und es werden Probleme gelöst, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie hatte. Daher sind sowohl Berechnungen, die im Fall von München Einsparungen von zehn Millionen Euro durch den Linux-Umstieg kalkulieren, als auch die in einer Gegenstudie errechneten Mehrkosten mit Vorsicht zu genießen. Unabhängig von der Frage, ob sich ein Umstieg von proprietärer auf quelloffene Software betriebswirtschaftlich rechtfertigen lässt, lohnt es sich deshalb, auch andere Aspekte in den Blick zu nehmen.
Unausgeschöpfte Potenziale
Dazu zählen gerade für öffentliche Körperschaften auch volkswirtschaftliche Fragen. Wie zahlreiche Gespräche mit IT-Verantwortlichen von Kommunen ergaben, sorgte schon der Umstiegsbeschluss der Stadt München für eine allgemein bessere Verhandlungsposition gegenüber Anbietern herkömmlicher Software. Mit anderen Worten: Schon die erwiesene Möglichkeit eines Umstiegs, mag er auch beschwerlich gewesen sein, hat sich für den ganzen öffentlichen Sektor ausgezahlt. Hinzu kommt das Potenzial regionaler Wirtschaftsförderung, das mit der Vergabe von Open-Source-Dienstleistungsaufträgen verbunden ist. Denn natürlich ist auch die quelloffene Software nicht kostenlos, aber die Mittel fließen an völlig andere, meist lokale Unternehmen. Dennoch gibt es gerade im Bereich der Entwicklung von Open-Source-Anwendungen noch eine Reihe unausgeschöpfter Potenziale, die vor allem im Bereich von Open-Source-Kooperationen liegen.
Dirk Riehle, Professor für Open Source Software an der Universität Nürnberg, plädiert daher für die verstärkte Bildung von Open-Source-Anwenderkonsortien. Was fehlt, sind Open-Source-Städtepartnerschaften, die aus der alten Tradition von Partnerstädten einen echten Mehrwert generieren. Denn bei vielen Anwendungen sind die Anforderungen verschiedener Kommunen sehr ähnlich. Trotzdem wird das Rad ständig neu erfunden oder parallel eingekauft. Im Bereich Open Source gibt es wirklich einen Anreiz, zu kooperieren und so betriebs- und volkswirtschaftliche Vorteile zusammenzuführen: Was einmal auf Basis von Open Source entwickelt wurde, steht automatisch auch allen anderen öffentlichen Körperschaften zur Weiternutzung und -entwicklung zur Verfügung.
Der größte Wandel ist aber weniger im ökonomischen als vielmehr im politischen Bereich zu beobachten. Vor zehn Jahren spielten politische Argumente für Open Source, wie größere Transparenz und ein freierer Zugang zu Wissen, nur eine untergeordnete Rolle. Heute lässt sich Open Source bis zu einem gewissen Grad als Weltanschauung bezeichnen, die weit über den Bereich von Software hinausreicht, sei es bei der Freigabe öffentlicher Datenbestände (Open Data), der Nutzung offener Lizenzen im Bildungsbereich (Open Education) oder ganz allgemeiner Prinzipien von Offenheit und Transparenz in der öffentlichen Verwaltung (Open Government).
Teilaspekt digitaler Offenheit
In diesem Sinne ist Open Source im Jahr 2014 nur noch ein Teilaspekt von digitaler Offenheit ganz allgemein. Für die Zukunft von Open Source Software im öffentlichen Sektor kann dieser Bedeutungsgewinn nur von Vorteil sein. In Städten wie Berlin oder Wien waren es nicht ökonomische Gründe, die einen erfolgreichen Umstieg auf Linux verhindert hatten – im Gegenteil, diese wurden bisweilen bewusst beiseite geschoben. Wien hält bis heute eine Studie unter Verschluss, die Kostenvorteile eines Umstiegs für Linux errechnet hatte. In beiden Städten mangelte es vielmehr an einer einzigen Sache, die in München über zehn Jahre stabil war: politische Unterstützung und Entschlossenheit für Open Source. Genau diese politische Dimension ist es deshalb auch, auf die es in den nächsten zehn Jahren ankommen wird.
Leonhard Dobusch ist Juniorprofessor für Organisationstheorie an der Freien Universität Berlin und leitet unter anderem das Forschungsprojekt „Digitaler Offenheitsindex“ (www.do-index.org).
http://www.do-index.org
Dieser Beitrag ist in der März-Ausgabe von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
Stichwörter: Open Government, Open Source, LiMux, München, Wien
Bildquelle: MEV Verlag/PEAK Agentur für Kommunikation
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Open Government
Bonn: Auf dem Weg zum Urban Data Management
[22.7.2024] Im städtischen Kontext fallen eine Vielzahl von Daten aus allen Bereichen der Gesellschaft an und werden gesammelt. Die Stadt Bonn hat eine Datenstrategie und Datengovernance für urbane Daten verabschiedet und will ihren Datenschatz durch ein umfassendes Urban Data Management zugänglich machen. mehr...
[22.7.2024] Im städtischen Kontext fallen eine Vielzahl von Daten aus allen Bereichen der Gesellschaft an und werden gesammelt. Die Stadt Bonn hat eine Datenstrategie und Datengovernance für urbane Daten verabschiedet und will ihren Datenschatz durch ein umfassendes Urban Data Management zugänglich machen. mehr...
Open Data: Ideen für ländliche Kommunen gesucht
[20.6.2024] Innovative Lösungen zum Einsatz von offenen Verwaltungsdaten in ländlichen Kommunen sucht jetzt das Bundeslandwirtschaftsministerium im Zuge eines Ideenwettbewerbs. mehr...
[20.6.2024] Innovative Lösungen zum Einsatz von offenen Verwaltungsdaten in ländlichen Kommunen sucht jetzt das Bundeslandwirtschaftsministerium im Zuge eines Ideenwettbewerbs. mehr...
Dresden: Digitale Lösungen gegen Extremwetter
[16.5.2024] Beim diesjährigen Open Data Camp der Stadt Dresden und der Sächsischen Staatskanzlei sollen die Teilnehmenden unter dem Motto „Cool down – Hack die Extreme“ kreative digitale Lösungen zur Anpassung an Extremwetterlagen entwickeln. mehr...
[16.5.2024] Beim diesjährigen Open Data Camp der Stadt Dresden und der Sächsischen Staatskanzlei sollen die Teilnehmenden unter dem Motto „Cool down – Hack die Extreme“ kreative digitale Lösungen zur Anpassung an Extremwetterlagen entwickeln. mehr...
Bayern: Kompetenz für Open Data
[10.5.2024] Ein Kompetenzzentrum für Open Data wollen in Bayern das Digitalministerium und die Digitalagentur byte etablieren. Das Portfolio des Kompetenzzentrums umfasst neben dem Open-Data-Portal umfassende Serviceleistungen, die den Einstieg in die Datenbereitstellung auch für kleinste Behörden und Kommunen möglich machen. mehr...
[10.5.2024] Ein Kompetenzzentrum für Open Data wollen in Bayern das Digitalministerium und die Digitalagentur byte etablieren. Das Portfolio des Kompetenzzentrums umfasst neben dem Open-Data-Portal umfassende Serviceleistungen, die den Einstieg in die Datenbereitstellung auch für kleinste Behörden und Kommunen möglich machen. mehr...
Open Government: Haushaltsdaten digital veröffentlichen
Bericht
[3.5.2024] Neben der Haushaltssatzung sollten die Bürgerinnen und Bürger auch auf den kommunalen Haushaltsplan jederzeit unkompliziert zugreifen können. Es empfiehlt sich deshalb die Online-Veröffentlichung. Der Einsatz digitaler Methoden sorgt darüber hinaus für mehr Transparenz und bessere Auswertungsmöglichkeiten. mehr...
[3.5.2024] Neben der Haushaltssatzung sollten die Bürgerinnen und Bürger auch auf den kommunalen Haushaltsplan jederzeit unkompliziert zugreifen können. Es empfiehlt sich deshalb die Online-Veröffentlichung. Der Einsatz digitaler Methoden sorgt darüber hinaus für mehr Transparenz und bessere Auswertungsmöglichkeiten. mehr...
Weitere FirmennewsAnzeige
E-Rechnung: Für den Ansturm rüsten
[31.5.2024] Die E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich kommt. Kommunen sollten jetzt ihre IT darauf ausrichten. Ein Sechs-Stufen-Plan, der als roter Faden Wege und technologische Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, kann dabei helfen. mehr...
Suchen...
Anzeige
Aboverwaltung
Aktuelle Meldungen

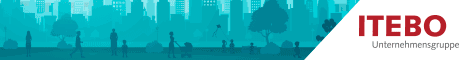






 AKDB Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
AKDB Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern



