Serie Smart Cities:
Zusammen zur smarten Region
[23.6.2023] Unter den bundesweit 73 geförderten Modellprojekten Smart Cities befinden sich auch einige stark ländlich geprägte Gemeinden und Kreise. Auf ihrem Weg zur smarten Region bietet die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen viele Synergieeffekte.
 Smarte Dörfer, Kleinstädte und ländliche Regionen stehen trotz unterschiedlicher regionaler Kontexte häufig vor ähnlichen Herausforderungen: Dazu gehören etwa die oft nicht optimalen Nahversorgungsmöglichkeiten, der demografische Wandel und die Abwanderung junger Menschen sowie ein öffentliches Nahverkehrsangebot mit Lücken in der Fläche und Taktung. Auf der anderen Seite punkten Landregionen mit einem anderen Wohnangebot als in der Stadt, Erholung im Grünen und einer oft besseren Luftqualität.
Smarte Dörfer, Kleinstädte und ländliche Regionen stehen trotz unterschiedlicher regionaler Kontexte häufig vor ähnlichen Herausforderungen: Dazu gehören etwa die oft nicht optimalen Nahversorgungsmöglichkeiten, der demografische Wandel und die Abwanderung junger Menschen sowie ein öffentliches Nahverkehrsangebot mit Lücken in der Fläche und Taktung. Auf der anderen Seite punkten Landregionen mit einem anderen Wohnangebot als in der Stadt, Erholung im Grünen und einer oft besseren Luftqualität.Digitale Lösungen können gerade in ländlichen Regionen helfen, die Daseinsvorsorge zu sichern, die Lebensqualität zu steigern oder Defiziten bei der medizinischen Versorgung entgegenzuwirken. Die großen Themen ländlich geprägter Gemeinden machen dabei an den eigenen Verwaltungsgrenzen nicht Halt – viel stärker noch als größere Städte sind sie darauf angewiesen, im Verbund zu agieren und sich als smarte Region aufzustellen.
Digitale Lösungen sichern Daseinsvorsorge
Die regionale Zusammenarbeit über Verwaltungsgrenzen hinweg ermöglicht Synergieeffekte. So nutzen smarte Regionen Ressourcen wie Personal oder Infrastruktur gemeinsam. Auch in Bereichen wie Wissenstransfer, Kompetenzaufbau und Standardisierung muss sich nicht jede Kommune alleine auf den Weg machen. Mit Blick auf knappe Haushaltsmittel können durch die interkommunale Zusammenarbeit Kosten gespart werden, beispielsweise durch gemeinsam bestellte Datenschutzbeauftragte und gemeinsame Datenplattformen. Das ist aber leichter gesagt als getan: Obwohl laut Trendreport „Digitaler Staat“ rund 80 Prozent der Kommunen in der interkommunalen Zusammenarbeit großes Potenzial sehen, wird dies bislang nicht in entsprechendem Maße gelebt. Während viele größere und mittlere Kommunen ihre Entwicklung zur Smart City organisatorisch verankern und dabei sind, Strukturen herauszubilden, fehlen insbesondere in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie den Landkreisen häufig noch entsprechende Strukturen und Verantwortlichkeiten.
Die vom Bund geförderten Modellprojekte Smart Cities erproben hier stellvertretend neue Organisationsmodelle für die interkommunale Zusammenarbeit. Ein Beispiel ist die gemeinsam getragene Digitalisierungsagentur in Form einer GmbH des Verbunds der 5 für Südwestfalen, welche die Entwicklung einer smarten Region über verschiedene Kommunen hinweg koordiniert. Ein anderer Ansatz ist das Regionallotsen-Modell des Landkreises Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz. Die Regionallotsen sind jeweils für eine Teilregion – je zwei bis drei Kommunen – zuständig. Ihre Aufgabe ist es, die Interessen „ihrer“ Kommunen in das Gesamtprojekt einzubringen und Informationen aus dem Gesamtvorhaben in die einzelnen Verwaltungen zu tragen.
Voneinander lernen
Im Rahmen der Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaft (AEG) „Smarte Regionen“, die vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) als Partner in der Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities begleitet wird, diskutieren die ländlich ausgerichteten Modellprojekte Smart Cities organisatorische Ansätze und Lösungen für die Herausforderungen vor Ort. Beispiel Nahversorgung in ländlichen Räumen: Die Modellprojekte verfolgen hier mit Online-Marktplätzen, Packstationen, nachhaltigen Lieferketten oder Verkaufsflächen in Gemeinschaftsorten unterschiedliche digital gestützte Ansätze.
Zur Realisierung einer smarten Region gehören aber nicht nur Maßnahmen, die mit digitalen Instrumenten die Lebensqualität in Stadt, Landkreis und Region voranbringen. Entscheidend wird es auch sein, ob ein regionales Bewusstsein, eine gemeinsame Identität oder Marke entwickelt werden kann, hinter der sich alle Kommunen einer smarten Region versammeln können. Auch hier geht es darum, voneinander zu lernen und gute Lösungen für die Breite zu entwickeln, etwa mit mobilen Angeboten zur Information und Mitwirkung an der digitalen Gestaltung der Region. Die Angebote dürfen dabei nicht rein standardisiert sein, sondern müssen an die spezifische Teilregion angepasst werden – in der einen Gemeinde ist womöglich eine begleitende Kinderbetreuung erforderlich, in der nächsten die Kooperation mit dem wichtigen lokalen Verein zielführend.
Regio-Hubs als Anlaufstelle
Nicht zuletzt geht es darum, den Menschen in einer Region zu verdeutlichen, in welcher Weise digitale Instrumente ihr Leben verändern werden und dass sich der digitale Wandel als örtliche Gemeinschaft gestalten lässt. Eine Vielzahl von Kommunen baut hierfür Ankerorte und Anlaufstellen auf – genannt Regio-Hubs, Stadtlabore, Maker-Spaces, Innovationsräume oder Dorfbüros. Damit verfolgen sie unterschiedliche Schwerpunkte: Sei es das Ziel, die Gemeinschaft zu stärken und Begegnung zu fördern, einen Ort für Bürgerbeteiligung, dezentrale Verwaltungsleistungen und Daseinsvorsorge zu schaffen oder eine Erlebnismöglichkeit für digitale Lösungen zu bieten. Darüber hinaus dienen solche Orte in verschiedenen Fällen auch als Co-Working-Spaces oder Innovationszentren sowie zur Start-up-Förderung. So wie das DiZ, das Digitalzentrum Amt Süderbrarup, das sich als Bildungseinrichtung, Begegnungsort und Entwicklungsstandort für bestehende und neue Wirtschaft versteht. Ein weiteres Beispiel ist das WALD | STADT | LABOR Iserlohn als offener Raum für alle, die an der digitalen Transformation und der nachhaltigen Entwicklung der Stadt mitwirken möchten. Es unterstützt die Diskussion zwischen Verwaltung, Politik, Bürgerschaft, Institutionen, Wirtschaft und Wissenschaft in Fragen der digitalen Entwicklung der Region.
Ziel: Wissen teilen
Ziel der AEG „Smarte Regionen“ ist es, Wissen zu teilen, konkrete Kooperationen zu vereinbaren und greifbare Mehrwerte für die inhaltliche Arbeit der Modellprojekte Smart Cities und weiterer Kommunen zu erzielen – etwa, indem sie praxisbewährte Konzepte oder gemeinsame digitale Tools teilen. Hierzu arbeiten die vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) geförderten Modellprojekte Smart Cities in verschiedenen Themenfeldern mit dem Forschungsprojekt „Smarte.Land.Regionen“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zusammen. Positiv wirkt: Das Bewusstsein für die smarte Region, die mit digitalen Ansätzen dazu beiträgt, ihren spezifischen Herausforderungen zu begegnen, wächst. Smart City ist damit nicht nur ein Privileg für größere Städte, sondern muss auch in Kleinstädten und Dörfern greifen.
Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS).
Serie Smart Cities,
Teil 1: Stärker durch interkommunale Kooperationen Teil 2: Urbane Datenplattformen Teil 3: Digitale Zwillinge Teil 4: Smarte Regionen Teil 5: Resilienz und Klimaanpassung Teil 6: Raumwirkung der Digitalisierung
Teil 1: Stärker durch interkommunale Kooperationen Teil 2: Urbane Datenplattformen Teil 3: Digitale Zwillinge Teil 4: Smarte Regionen Teil 5: Resilienz und Klimaanpassung Teil 6: Raumwirkung der Digitalisierung
Teil eins der Serie Smart Cities (Deep Link)
Teil zwei der Serie Smart Cities (Deep Link)
Teil drei der Serie Smart Cities (Deep Link)
Teil fünf der Serie Smart Cities (Deep Link)
https://www.smart-city-dialog.de/modellprojekte
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juni 2023 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
Stichwörter: Smart City, Smart Region, 5 für Südwestfalen, Iserlohn
Bildquelle: Stadt Iserlohn
Anzeige
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Smart City
Kreis Hof: Stadtplanung in der virtuellen Realität
[8.5.2024] Gemeinsam mit der Hochschule Hof arbeitet das Smart-City-Team des Landkreises Hof an einer Virtual-Reality-Anwendung. Durch die Simulationen soll den Bürgern das Thema nachhaltige Stadtplanung nahegebracht werden. mehr...
[8.5.2024] Gemeinsam mit der Hochschule Hof arbeitet das Smart-City-Team des Landkreises Hof an einer Virtual-Reality-Anwendung. Durch die Simulationen soll den Bürgern das Thema nachhaltige Stadtplanung nahegebracht werden. mehr...
Digitale Zwillinge: Vielfältige Möglichkeiten
Bericht
[7.5.2024] In zahlreichen Städten wird bereits an der Umsetzung eines Digitalen Zwillings gearbeitet – dabei werden die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten erprobt. Von den gesammelten Erfahrungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
[7.5.2024] In zahlreichen Städten wird bereits an der Umsetzung eines Digitalen Zwillings gearbeitet – dabei werden die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten erprobt. Von den gesammelten Erfahrungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Gelsenkirchen: KI-Anwendungszentrum gegründet
[3.5.2024] KI bietet auch im kommunalen Kontext zahlreiche produktive Anwendungsmöglichkeiten. Die Stadt Gelsenkirchen gründet jetzt im Rahmen ihrer Digitalisierungs- und Innovationsinitiative gemeinsam mit der Westfälischen Hochschule ein Anwendungszentrum für KI in Kommunen. mehr...
[3.5.2024] KI bietet auch im kommunalen Kontext zahlreiche produktive Anwendungsmöglichkeiten. Die Stadt Gelsenkirchen gründet jetzt im Rahmen ihrer Digitalisierungs- und Innovationsinitiative gemeinsam mit der Westfälischen Hochschule ein Anwendungszentrum für KI in Kommunen. mehr...
Frankenberg (Eder): Use Cases für Smart City
[2.5.2024] Vor einem Jahr hatte die hessische Kleinstadt Frankenberg (Eder) eine Förderzusage des Landes für ihre Smart-City-Maßnahmen erhalten. Nun haben Kommune und IT-Dienstleister eine erste Zwischenbilanz gezogen. mehr...
[2.5.2024] Vor einem Jahr hatte die hessische Kleinstadt Frankenberg (Eder) eine Förderzusage des Landes für ihre Smart-City-Maßnahmen erhalten. Nun haben Kommune und IT-Dienstleister eine erste Zwischenbilanz gezogen. mehr...
Bürger-App: Kommunale Kommunikation
Bericht
[26.4.2024] Bürger-Apps ermöglichen den unkomplizierten, direkten Austausch zwischen Kommunen und Einwohnern. Die Smart Village App ist ein offenes Baukastensystem speziell für Kommunen, das individuell angepasst werden kann. Rund 40 Kommunen nutzen es bereits - darunter auch die Stadt Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern. mehr...
[26.4.2024] Bürger-Apps ermöglichen den unkomplizierten, direkten Austausch zwischen Kommunen und Einwohnern. Die Smart Village App ist ein offenes Baukastensystem speziell für Kommunen, das individuell angepasst werden kann. Rund 40 Kommunen nutzen es bereits - darunter auch die Stadt Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern. mehr...
Suchen...
Anzeige
Anzeige
Aboverwaltung
Aktuelle Meldungen


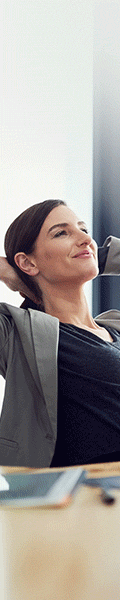










 STERNBERG Software GmbH & Co. KG
STERNBERG Software GmbH & Co. KG



