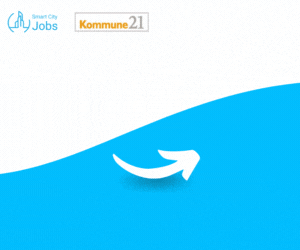Serie OZG:
Am Nutzer orientiert
[5.9.2019] Die Arbeiten an der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes laufen auf Hochtouren. Digitalisierungslabore bringen Schwung in die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Bund, Länder und Kommunen agieren vereint. Teil 1 einer neuen Serie.
 Die Sondernutzung von Straßen – beispielsweise zur Einrichtung einer Baustelle, für Außengastronomie oder ein temporäres Halteverbot – ist kompliziert zu beantragen. Es gibt eine Vielzahl von Anforderungen und kommunalen Sonderregeln. Oft wissen Bürger nicht, wann eine Beantragung notwendig ist, oder sie finden die entsprechenden Informationen und zuständigen Stellen nicht. In der Verwaltung führen die Anträge zu vielen Rückfragen, sodass Bearbeitungszeiten von sechs Wochen durchaus üblich sind. Mitunter erfolgt die Rechnungsstellung erst im Folgejahr. Das ist erstaunlich für einen Prozess, der zu den häufig nachgefragten Verwaltungsleistungen zählt und eigentlich eine Routinearbeit darstellen müsste – eine Routinearbeit, die sich digitalisieren lässt.
Die Sondernutzung von Straßen – beispielsweise zur Einrichtung einer Baustelle, für Außengastronomie oder ein temporäres Halteverbot – ist kompliziert zu beantragen. Es gibt eine Vielzahl von Anforderungen und kommunalen Sonderregeln. Oft wissen Bürger nicht, wann eine Beantragung notwendig ist, oder sie finden die entsprechenden Informationen und zuständigen Stellen nicht. In der Verwaltung führen die Anträge zu vielen Rückfragen, sodass Bearbeitungszeiten von sechs Wochen durchaus üblich sind. Mitunter erfolgt die Rechnungsstellung erst im Folgejahr. Das ist erstaunlich für einen Prozess, der zu den häufig nachgefragten Verwaltungsleistungen zählt und eigentlich eine Routinearbeit darstellen müsste – eine Routinearbeit, die sich digitalisieren lässt.Genau das passiert inzwischen. Unter Federführung der Freien und Hansestadt Hamburg haben sich Vertreter der Kommunen Düsseldorf, Mannheim und Hohe Börde sowie Beschäftigte aus Gastronomie- und Bauunternehmen zusammengesetzt, um einen digitalen Prozess für das Beantragungsprozedere „Sondernutzung von Straßen“ zu entwerfen. In einem Digitalisierungslabor wurde der Prozess nach den Prinzipien von Design Thinking und Scrum aus Nutzerperspektive konzipiert. Er soll für mehr Transparenz sorgen und frühere Schwachstellen bei der Beantragung berücksichtigen. Auf diese Weise ist ein digitaler Prototyp für den Verwaltungsprozess entstanden – ein Baustein von vielen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).
Perspektivwechsel setzt ein
Das OZG sieht vor, dass bis Ende 2022 im Prinzip alle Verwaltungsdienste digital verfügbar sein müssen und online nutzbar sind. 575 Leistungen wurden hierfür identifiziert, in 35 Lebens- und 17 Unternehmenslagen gebündelt sowie 14 übergeordneten Themenfeldern zugeordnet, zum Beispiel „Familie und Kind“, „Bauen und Wohnen“ oder „Unternehmensführung und -entwicklung“. Mehr als 25 Digitalisierungslabore haben inzwischen ihre Arbeit aufgenommen und sind mit der Umsetzung von OZG-Prozessen beschäftigt. In allen Laboren sind Vertreter von Bund und Ländern, Praktiker aus den Kommunen, Rechtsexperten und Techniker sowie gewöhnliche Nutzer vertreten, die nach soziodemografischen Gesichtspunkten ausgewählt wurden.
Die Nutzerperspektive ist das Credo in den Digitalisierungslaboren. Nachdem viele Digitalisierungsprojekte der öffentlichen Hand, angefangen beim neuen Personalausweis über De-Mail und die elektronische Gesundheitskarte bis hin zum elektronischen Entgeltnachweis (ELENA), entweder vom Bürger nicht angenommen wurden oder sogar gescheitert sind, hat ein Umdenken eingesetzt, ein Perspektivwechsel: Nutzerfreundlichkeit und Nachnutzung sind zu neuen Leitideen bei der Umsetzung des OZG geworden.
OZG sorgt für Bewegung
„Wir haben die Governance-Struktur angepasst an die föderale Struktur“, beschrieb der IT-Beauftragte der Bundesregierung, Klaus Vitt, auf dem Zukunftskongress Ende Mai die für sein Haus, das Bundesinnenministerium (BMI), ungewöhnliche Herangehensweise. Dass nun handverlesene Bürger neben Beamten des Bundes und Experten aus Ländern und Kommunen in den Digitalisierungslaboren ein Wörtchen mitreden, kann als kleine Revolution gelten. Normalerweise hat der Bund wenig Berührungspunkte mit der kommunalen Ebene. An den Digitalisierungslaboren beteiligen sich indessen mehr als 80 Kommunen. Ernst Bürger, Abteilungsleiter im BMI und in der Hauptsache mit dem OZG befasst, erklärt: „Das OZG ist dann erfolgreich, wenn die Angebote später genutzt werden.“
Das im August 2017 beschlossene Onlinezugangsgesetz hat der Digitalisierung hierzulande auf die Sprünge geholfen. Allenthalben ist bei der Umsetzung ein neuer Schwung zu verspüren, berichten Beteiligte aus den Laboren. „Das OZG hat zu echter Bewegung geführt und Geld und Stellen geschaffen“, sagt Ernst Bürger. Allein der Bund stellt 500 Millionen Euro für seinen Teil an der OZG-Umsetzung zur Verfügung. Dazu gehören das Bundesportal, Nutzerkonten, Maßnahmen für den Portalverbund sowie 115 so genannte Typ1-Leistungen aus dem OZG-Katalog, für die der Bund verantwortlich zeichnet. Zusätzlich stellt der Bund 180 Millionen Euro für den Aufbau der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) zur Verfügung, ein Kontroll- und Steuerungsgremium mit Sitz in Frankfurt am Main, das ab Januar kommenden Jahres unter anderem die Aufgaben des IT-Planungsrats übernehmen soll. Wie viel die Länder und Kommunen für das OZG ausgeben werden, ist unklar. Der Normenkontrollrat geht von insgesamt zwei Milliarden Euro aus.
Vielseitiges Know-how
Dabei ist klar: Bei Null fängt keine der föderalen Ebenen an. Bund, Länder und Kommunen sind seit Langem bei der Digitalisierung aktiv und bringen ihre Infrastruktur, ihr Know-how und so manchen bereits fertigen digitalen Prozess in das Gesamtprojekt ein – von der Kita-Anmeldung bis hin zur internetbasierten Fahrzeugzulassung. Gleichwohl gibt es noch viel zu tun. Immerhin sind die Länder für 370 OZG-Leistungen zuständig und die Kommunen für weitere 90.
Der Nationale Normenkontrollrat, der seit jeher ein kritisches Auge auf die Digitalisierung der Verwaltung wirft, hat der OZG-Umsetzung in seinem aktuellen „Monitor Digitale Verwaltung“ einen geglückten Start attestiert. Ausdrücklich werden die neue Form der föderalen Kooperation und die Nutzerorientierung begrüßt und gelobt. Gleichzeitig macht das politische Kontrollgremium darauf aufmerksam, dass die Zusammenarbeit erst dann Bestand hat, wenn es daran geht, die Ergebnisse der Digitalisierungslabore in die Fläche zu bringen. Aus den Laboren gehen digitale Prototypen hervor, so genannte Blaupausen für die Nachnutzung. Der Idee nach sollen diese Prototypen von allen Verwaltungsstellen, die sie benötigen, übernommen und in die eigene IT-Architektur implementiert werden. Wünschenswert sei hierfür die „Konzeption einer Plattformlandschaft, die Portale, Register, Fachverfahren und Basisinfrastrukturen auf einfache und modulare Weise miteinander verbindet. Dies würde es den Beteiligten, allen voran den Kommunen, erleichtern, die OZG-Entwicklungsergebnisse zu übernehmen“, so der Nationale Normenkontrollrat.
Heterogenität ist die Wirklichkeit
Es kann als sicher gelten, dass es bis zum Ende der OZG-Umsetzungsfrist einen solchen Modellbaukasten nicht geben wird. Aus der Vorstellung spricht der starke Wunsch des Bundeskanzleramts nach einer standardisierten, einheitlichen IT-Infrastruktur, die, so wünschenswert sie auch erscheinen mag, den Tatsachen der heterogenen deutschen IT-Landschaft und dem kommunalen Selbstverständnis nicht entspricht. Kommunen investieren seit Jahrzehnten in ihre IT, und es ist verständlich, dass sie funktionierende Systeme nun nicht über Bord werfen wollen. Die Implementierung einer Lösung ist ohnehin den Ländern und Kommunen überlassen. Gleichwohl erscheint der Appell des Normenkontrollrats, „Althergebrachtes ein Stück weit aufzugeben und neue Wege zu gehen“ nicht abwegig – zumindest, wenn die neue digitale Lösung besser ist als die alte.
Helmut Merschmann
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe September 2019 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
Stichwörter: Portale, CMS, Onlinezugangsgesetz (OZG)
Bildquelle: Bitter/stock.adobe.com
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich CMS | Portale
Augsburg: Online mehr Service
Bericht
[25.4.2024] Mit einem kontinuierlichen Ausbau der Online-Dienste, einem Chatbot als zusätzlichem Kommunikationskanal sowie Hilfe bei der Digitalisierung sorgt die Stadt Augsburg für Bürgerservice. Auch verwaltungsinterne Optimierungen sind in vollem Gange. mehr...
[25.4.2024] Mit einem kontinuierlichen Ausbau der Online-Dienste, einem Chatbot als zusätzlichem Kommunikationskanal sowie Hilfe bei der Digitalisierung sorgt die Stadt Augsburg für Bürgerservice. Auch verwaltungsinterne Optimierungen sind in vollem Gange. mehr...
Gummersbach: Serviceportal eingeführt
[19.4.2024] Ihr neues Serviceportal hat jetzt die nordrhein-westfälische Stadt Gummersbach freigeschaltet. Mehr als 200 Leistungen stehen zum Start des Portals zur Verfügung. mehr...
[19.4.2024] Ihr neues Serviceportal hat jetzt die nordrhein-westfälische Stadt Gummersbach freigeschaltet. Mehr als 200 Leistungen stehen zum Start des Portals zur Verfügung. mehr...
cit/komuna: E-Government kann auch einfach sein
[19.4.2024] Der mittelständische IT-Dienstleister komuna nutzt cit intelliForm als Plattform für Teile seines Produkts „Rathaus Service-Portal“ und profitiert von der großen Menge an fertigen Bausteinen. Mehr als 550 Kommunen in Bayern nutzen die Lösung bereits. mehr...
[19.4.2024] Der mittelständische IT-Dienstleister komuna nutzt cit intelliForm als Plattform für Teile seines Produkts „Rathaus Service-Portal“ und profitiert von der großen Menge an fertigen Bausteinen. Mehr als 550 Kommunen in Bayern nutzen die Lösung bereits. mehr...
Kreis Segeberg: Einer für vieles
Bericht
[16.4.2024] Ein Online-Service bündelt im Kreis Segeberg mehrere Leistungen für hilfebedürftige Menschen, sodass diese ihre Daten nur einmal eingeben müssen. Dataport hat den Dienst in einem Referenzprojekt mit dem Land im Auftrag des ITV.SH entwickelt. mehr...
[16.4.2024] Ein Online-Service bündelt im Kreis Segeberg mehrere Leistungen für hilfebedürftige Menschen, sodass diese ihre Daten nur einmal eingeben müssen. Dataport hat den Dienst in einem Referenzprojekt mit dem Land im Auftrag des ITV.SH entwickelt. mehr...
Cuxhaven: Mängel einfacher melden
[12.4.2024] Der neue Mängelmelder der Stadt Cuxhaven ist online: Mit der Umstellung gehen Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger einher. Sie sollen in nur wenigen Schritten einen digitalen Hinweis geben können. mehr...
[12.4.2024] Der neue Mängelmelder der Stadt Cuxhaven ist online: Mit der Umstellung gehen Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger einher. Sie sollen in nur wenigen Schritten einen digitalen Hinweis geben können. mehr...
Suchen...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Aboverwaltung
Aktuelle Meldungen